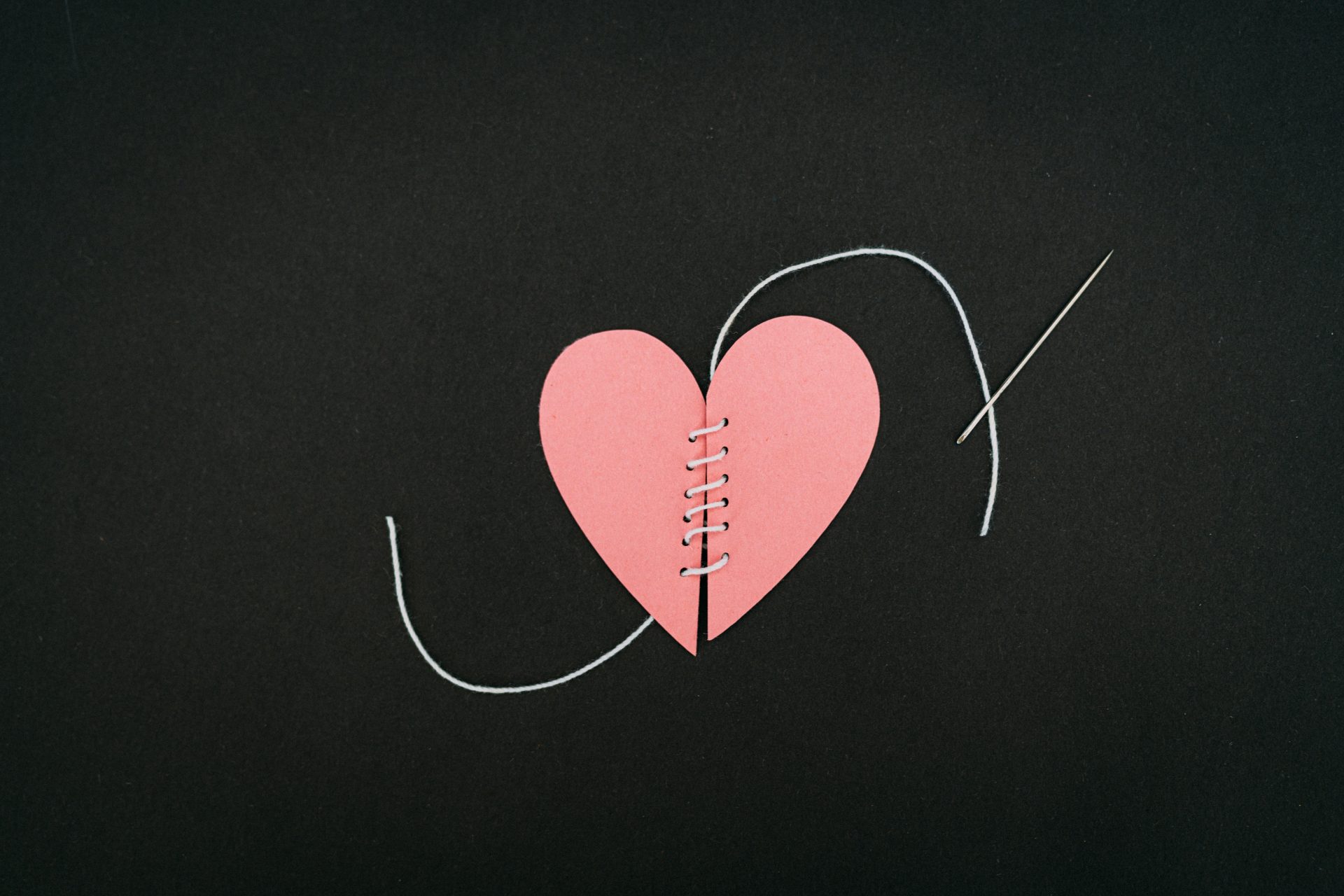Fettgedrucktes für schnell Leser…
Einleitender Impuls:
Manchmal bleibe ich beim Zähneputzen am Spiegel hängen. Nicht, weil da etwas besonders Wichtiges zu sehen wäre – eher im Gegenteil. Ein ganz normaler Moment zwischen Müdigkeit und Routinen. Und doch: Für einen Atemzug schaue ich nicht auf mein Gesicht, sondern in etwas Tieferes. Ich sehe mich nicht – ich werde gesehen. Und merke plötzlich: Da ist etwas still in mir geworden. Nicht ruhig. Nur still. Wie ein Raum, in dem man unwillkürlich langsamer spricht, weil man spürt, dass etwas anwesend ist, das nicht laut werden will. Etwas, das nicht erklärt, sondern gewahrt werden will.
Als ich den Satz las – „Ich habe die Welt überwunden“ – war es nicht der Inhalt, der mich traf. Es war der Moment, in dem Jesus ihn spricht. Nicht nach dem Sieg, sondern davor. Vor dem Garten. Vor dem Schrei. Vor dem Moment, in dem ihm niemand mehr bleibt. Ich habe ehrlich gesagt eine Weile gebraucht, um das zu verstehen. Denn wir lesen diesen Satz oft, als wäre er der Schlusspunkt. Aber Jesus sagt ihn nicht nachdem er alles durchgestanden hat – sondern bevor es beginnt. Das ist keine Rückschau. Es ist Gewissheit – mitten in der Dunkelheit. Was mich bewegt, ist, dass er nicht sagt „Ich werde“, sondern „Ich habe“. Dass er das sagt, während die Bedrängnis schon am Horizont steht. Noch nicht greifbar – aber spürbar nah. Und das verändert alles. Denn wenn sein Friede da schon trägt, dann muss meiner nicht warten, bis alles gut wird.
Ich stelle meine Zahnbürste zurück, werfe mir noch einen Blick zu – nicht kritisch, sondern wie einer, der sich kurz erinnert. Ein stilles: „Stimmt ja.“ Und während ich mich umdrehe, denke ich an die vielen, die gerade nicht wissen, wo oben und unten ist. An Situationen, in denen man in den Spiegel schaut und sich fragt, wo dieser Friede eigentlich sein soll, von dem Jesus spricht. Und ich sage dir: Er ist da. Nicht als Flucht vor dem Schmerz. Nicht als rosa Schleife auf dem Leid. Sondern als Gegenwart mitten im Zerbruch.
Nicht alles ist ein Drama. Aber es gibt sie – die echten Dramen, die weh tun und nichts erklären. Und wenn sie geschehen, lässt sich nichts zurückholen, nichts rückgängig machen. Dann bleibt nur noch eine Frage: Nicht „Warum?“, sondern „Wie?“
Und genau darauf antwortet Jesus – nicht mit einer Theorie, sondern mit sich selbst. Mit einem Frieden, der durchhält, wenn alles andere zerfällt. Das ist es, was ich glaube. Und das ist es, was wir an Ostern feiern: Er lebt. Und du darfst mit ihm leben – auch dann, wenn deine Welt gerade zerbricht.
Fragen zur Vertiefung oder für Gruppengespräche:
- Was macht es mit dir, wenn Jesus von Sieg spricht, bevor das Leiden beginnt?
- Wo könntest du in deinem Alltag beginnen, nicht auf Frieden zu warten – sondern ihn wahrzunehmen, wo du stehst?
- Was bedeutet es für dich persönlich, mit jemandem zu leben, der die Welt bereits überwunden hat?
Parallele Bibeltexte als Slogans mit Anwendung:
Jesaja 26,3 – „Du bewahrst den festen Sinn.“ → Gottes Friede beginnt nicht nach dem Sturm, sondern mitten in der Entscheidung, ihm zu vertrauen.
Johannes 14,27 – „Meinen Frieden gebe ich euch.“ → Nicht wie die Welt ihn gibt – sondern wie ein Vater, der weiß, was kommt.
Römer 8,37 – „Mehr als Überwinder.“ → Nicht weil wir stark sind, sondern weil er uns mitträgt – selbst im Ungewissen.
2. Korinther 4,8–9 – „Von allen Seiten bedrängt – und doch nicht verloren.“ → Der äußere Druck muss nicht das letzte Wort haben.
Wenn du spürst, dass dieser Text nicht nur Worte transportiert, sondern etwas zum Klingen bringt – nimm dir 20 Minuten Zeit. Im Anschluss findest du die ganze Ausarbeitung – ehrlich, tief und vielleicht genau das, was du heute brauchst.
Möchtest du dich noch weiter in dieses Thema vertiefen? Im Anschluss findest du die Schritte die ich für diesen Impuls gegangen bin…
Bevor wir tiefer einsteigen, lass uns einen Moment sammeln… manchmal brauchen wir erst einen inneren Atemzug, bevor Worte wirklich ankommen.
Liebevoller Vater, du kennst unser Herz – die Ecken, in denen sich Zweifel einnisten, und die Räume, in denen wir Frieden suchen.
Du hast durch Jesus gesagt: „In mir habt ihr Frieden.“ Nicht irgendwo, nicht irgendwann, sondern in dir. Und wir sehnen uns danach – gerade mitten in der Welt, die manchmal laut, fordernd, bedrängend ist.
Danke, dass du nicht abwartest, bis wir stark sind, sondern uns Mut zusprichst, wenn wir am Kippen sind. Danke, dass Jesu Sieg nicht Theorie ist, sondern ein Ort, zu dem wir gehören dürfen.
Hilf uns jetzt, aufmerksam zu sein – nicht nur mit den Ohren, sondern mit dem Herzen.
Sprich zu uns, so wie ein Vater spricht – klar, ehrlich, tröstlich. Und wenn nötig, auch herausfordernd. Wir wollen dich hören.
Amen.
Ok, bereit? Dann lass uns jetzt tiefer eintauchen – nicht in trockene Fakten, sondern in das, was zwischen den Zeilen pulsiert…
Der Text:
Zunächst werfen wir einen Blick auf den Text in verschiedenen Bibelübersetzungen. Dadurch gewinnen wir ein tieferes Verständnis und können die unterschiedlichen Nuancen des Textes in den jeweiligen Übersetzungen oder Übertragungen besser erfassen. Dazu vergleichen wir die Elberfelder 2006 (ELB 2006), Schlachter 2000 (SLT), Luther 2017 (LU17), Basis Bibel (BB) und die Hoffnung für alle 2015 (Hfa).
Johannes 16,33
ELB 2006: Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis; aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden.
SLT: Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden!
LU17: Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.
BB: Das habe ich euch gesagt, damit ihr bei mir Frieden findet. In der Welt habt ihr Angst. Aber fasst Mut, ich habe die Welt besiegt!«
HfA: Dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr durch mich Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, aber lasst euch nicht entmutigen: Ich habe diese Welt besiegt.«
Der Kontext:
In diesem Abschnitt geht es darum, die grundlegenden Fragen – das „Wer“, „Wo“, „Was“, „Wann“ und „Warum“ – zu klären. Das Ziel ist es, ein besseres Bild von der Welt und den Umständen zu zeichnen, in denen dieser Vers verfasst wurde. So bekommen wir ein tieferes Verständnis für die Botschaft, bevor wir uns den Details widmen.
Kurzgesagt… Wir sind immer noch bei Jesus, mitten in dieser dichten Nacht, in der er seine Freunde auf das vorbereitet, was unausweichlich ist – und doch irgendwie tragbar werden soll. Der Ort ist derselbe, die Atmosphäre dieselbe – nur der Fokus verschiebt sich: Vom Schmerz zur Standfestigkeit. Von der Verwirrung zum Mut. Vom Weinen zum Frieden.
So wie gestern schon angedeutet, sind wir im gleichen Kapitel unterwegs – Johannes 16, ein Abschnitt, der eher wie ein Abschiedsgespräch wirkt als wie ein theologischer Vortrag. Es ist ein Moment zwischen Tür und Abgrund, in dem Jesus seine Jünger auf das einstimmt, was sie weder verstehen noch verhindern können: dass er geht. Und dass sie bleiben. Nicht als Waisen, aber als Menschen, die erst mal leer dastehen. Was gestern noch die Ahnung von Trauer war, wird jetzt zur klaren Realität: „In der Welt habt ihr Bedrängnis.“ Kein „vielleicht“, kein „unter Umständen“. Sondern einfach: Ihr werdet es spüren.
Die Situation ist damit nicht neu, aber sie bekommt einen anderen Ton. Jesus sagt ihnen nicht mehr nur, dass der Schmerz kommt – er sagt ihnen, wie sie darin bestehen können. Nicht, indem sie sich zusammenreißen oder irgendwas optimistisch wegatmen. Sondern indem sie sich erinnern: an ihn. „In mir habt ihr Frieden.“ Es ist, als würde er ihnen einen inneren Ort zeigen, noch bevor die äußere Welt auseinanderfällt. Eine Zuflucht, die nicht davon abhängt, ob sie alles richtig machen – sondern davon, dass er alles vollendet.
Und Johannes, der das später aufschreibt, tut das mit einem Blick, der tiefer geht. Er will nicht nur berichten, was Jesus gesagt hat – sondern zeigen, was dieses Wort in Menschen auslösen kann, die es brauchen. Menschen wie uns. Die vielleicht nicht im Garten Gethsemane sitzen, aber trotzdem wissen, wie sich Abschiede anfühlen. Und Dunkelheit. Und der Wunsch nach Frieden, der mehr ist als ein gutes Gefühl.
Wir könnten also sagen: Was gestern als Ahnung durch den Text klang, wird heute zur Ansage. Keine Vertröstung, sondern Verortung. Keine Weltflucht, sondern ein innerer Halt. Und genau deshalb lohnt es sich, jetzt tiefer zu schauen – auf diese wenigen Worte, die Jesus uns hier mitgibt wie eine Art geistlichen Proviant für harte Wege.
Komm, wir packen das gemeinsam aus. Ganz langsam. Jedes Wort ein Stück Weg.
Die Schlüsselwörter:
In diesem Abschnitt wollen wir uns genauer mit den Schlüsselwörtern aus dem Text befassen. Diese Worte tragen tiefere Bedeutungen, die oft in der Übersetzung verloren gehen oder nicht auf den ersten Blick ersichtlich sind. Wir werden die wichtigsten Begriffe aus dem ursprünglichen Text herausnehmen und ihre Bedeutung näher betrachten. Dabei schauen wir nicht nur auf die wörtliche Übersetzung, sondern auch darauf, was sie für das Leben und den Glauben bedeuten. Das hilft uns, die Tiefe und Kraft dieses Verses besser zu verstehen und ihn auf eine neue Weise zu erleben.
Johannes 16,33 – Ursprünglicher Text (Nestle-Aland 28):
Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ἐν ἐμοὶ εἰρήνην ἔχητε. ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἔχετε· ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον.
Übersetzung Johannes 16,33 (Elberfelder 2006):
Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis; aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden.
Semantisch-pragmatische Kommentierung der Schlüsselwörter
- θλῖψιν (thlipsin) – „Bedrängnis“: Das ist kein sanfter Druck, sondern eher wie ein Schraubstock, der sich um dein Leben legt. Das griechische Wort beschreibt eine existenzielle Enge – innerlich wie äußerlich. Nicht nur Stress, sondern das Gefühl, kaum noch atmen zu können. Es geht um die ganze Spannbreite von seelischer Not bis körperlicher Verfolgung. Jesus verspricht hier nicht die Abwesenheit solcher Zustände – sondern benennt sie nüchtern, fast seelsorgerlich: Sie werden kommen. Aber du wirst ihnen nicht schutzlos ausgeliefert sein.
- θαρσεῖτε (tharseite) – „Seid guten Mutes“: Ein Imperativ mit Herz. Kein militärisches „Reiß dich zusammen“, sondern ein leises, festes „Vertrau mir“. Das Wort taucht auf, wenn Jesus Menschen anspricht, die am Boden sind – Kranke, Verzweifelte, Erschöpfte. Es ist Mut, der nicht aus Selbstvertrauen wächst, sondern aus dem Wissen, dass da jemand ist, der bleibt. Vielleicht kein Mut mit geballter Faust – aber einer mit festem Blick.
- εἰρήνην (eirēnēn) – „Frieden“: Das ist kein Urlaubsgefühl und kein inneres Chill-out – sondern ein geistlicher Zustand der Versöhnung, der mitten im Sturm gilt. Im Hebräischen würde man „Schalom“ sagen – das meint: Ganzheit, heilende Ordnung, Geborgenheit im tiefsten Sinn. Jesus sagt: Dieser Friede kommt nicht aus dir selbst. Er kommt aus mir. Und du kannst ihn haben – auch wenn alles in dir schreit.
- κόσμον (kosmon) – „Welt“: Das Wort „kosmos“ hat hier nichts mit dem Universum zu tun – sondern mit der vernetzten Wirklichkeit des Gott-abgewandten Systems. Es ist die Welt, wie sie funktioniert ohne Gott: leistungsgetrieben, ungerecht, hart. Und genau diese Welt hat Jesus „überwunden“. Das ist keine Weltflucht – das ist ein Durchbruch. Nicht um die Welt zu verlassen, sondern um ihr die letzte Macht zu nehmen.
- νενίκηκα (nenikēka) – „ich habe überwunden“: Perfektform. Abgeschlossen. Gültig. Steht da nicht „ich werde“, nicht „ich bin dabei“ – sondern: Es ist schon geschehen. Noch vor dem Kreuz spricht Jesus diesen Sieg aus. Nicht als Wunsch, sondern als Tatsache. Dahinter steckt das Verb „nikaō“, das man auch mit „siegen“ oder „triumphieren“ übersetzen könnte. Aber es geht hier nicht um ein Heldenepos – sondern um den leisen Triumph der Liebe über das System der Angst. Christus hat nicht nur gekämpft. Er hat durchgehalten. Und gewonnen. Für uns.
Und genau hier liegt der Punkt, an dem Sprache aufhört, bloß Mitteilung zu sein – und anfängt, Glaube zu werden. Diese Wörter tragen mehr als Bedeutung. Sie tragen Erfahrung. Jesu Erfahrung. Unsere vielleicht auch. Was er sagt, ist nicht nur wahr – es ist gelebt, getragen, durchlitten.
Und genau das wollen wir jetzt theologisch tiefer greifen: nicht, um die Wörter zu sezieren, sondern um ihre Kraft zu verstehen. Was heißt es wirklich, wenn Jesus sagt: „Ich habe die Welt überwunden“? Was bedeutet „Frieden“, wenn alles wankt? Lass uns genau da ansetzen – und schauen, wie dieser Text in die Tiefe führt.
Ein Kommentar zum Text:
Es ist ein erstaunlicher Satz, den Jesus hier sagt – kurz, klar, beinahe beiläufig. Und doch trägt er das ganze Gewicht des Evangeliums in sich: „In der Welt habt ihr Bedrängnis; aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden.“ Die Leitfrage, die sich dabei stellt, ist keine rhetorische, sondern zutiefst existentielle: Wie kann man in einer Welt voller Enge, Druck und Schmerz Mut fassen – nicht als fromme Floskel, sondern als Lebenshaltung?
Wie schon gesagt: Jesus spricht diese Worte nicht im Triumph, sondern im Übergang. Nicht nach der Auferstehung, sondern davor. Der Satz steht in der Nacht, vor dem Garten, vor dem Kreuz, vor der Flucht der Jünger. Und doch sagt er im Perfekt: νενίκηκα τὸν κόσμον – (nenikēka ton kosmon) – „Ich habe die Welt überwunden.“ Das ist kein hoffnungsvolles „Ich werde“ oder ein kämpferisches „Ich bin dabei“ – sondern eine proklamierte Wirklichkeit im Voraus. Man könnte sagen: Der Glaube redet hier nicht der Realität schön, sondern der Realität ins Gesicht – mit einer Wahrheit, die tiefer reicht.
Was aber meint diese „Welt“, die überwunden ist? Das Wort κόσμος (kosmos) ist im Johannesevangelium vielschichtig. Es meint nicht die Schöpfung im neutralen Sinne, sondern ein System, das sich gegen Gott stellt, das Jesus ablehnt und seinen Weg nicht versteht (vgl. Johannes 1,10–11). Die Welt ist nicht nur der Ort der Bedrängnis, sondern die Bühne eines geistlichen Konflikts. Paulus würde sagen: „Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte“ (vgl. Epheser 6,12). Johannes hingegen sagt: Jesus hat genau diese Welt – dieses System der Angst, des Unrechts, des Misstrauens – überwunden. Das Verb νικάω (nikaō) hat dabei eine doppelte Stoßrichtung: Es meint Sieg, aber keinen mit Gewalt. Sondern einen, der bleibt. Einen, der auf Treue beruht – nicht auf Triumph.
Die Spannung liegt darin, dass dieser Sieg schon ausgesprochen ist – aber noch nicht sichtbar. Und genau hier greift der zweite Begriff ins Leben: θλῖψις (thlipsis) – „Bedrängnis“. Jesus verwendet kein neutrales Wort. Es geht um Enge, Druck, Zermalmung. Um das Gefühl, nicht mehr zu wissen, wo oben und unten ist. Es ist das gleiche Wort, das Paulus in Apostelgeschichte 14,22 gebraucht: „Wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen.“ Das ist keine Endzeitpanik – das ist gelebter Glaube unter Widerstand. Und genau dorthin hinein spricht Jesus Frieden.
Aber eben nicht irgendeinen Frieden. εἰρήνην (eirēnēn) – das ist nicht nur innere Ruhe, sondern Shalom in griechischem Gewand: heilende Ganzheit, Versöhnung mit Gott, mit sich selbst und mit der Welt – gerade dann, wenn nichts passt. Man könnte sagen: ein Friede, der nicht aus der Situation kommt, sondern gegen sie gehalten wird. Und dieser Friede hat ein Zuhause: „in mir“, sagt Jesus. Nicht in religiöser Leistung, nicht in der Kontrolle, nicht einmal in der Gemeinschaft – sondern in ihm. Das „in mir“ (ἐν ἐμοὶ, en emoi) ist mehr als eine Ortsangabe. Es ist eine Beziehungstiefe. Eine Verbundenheit, die sogar dann trägt, wenn das Sichtbare wankt. Vgl. Johannes 15,4: „Bleibt in mir, und ich in euch.“
Was Jesus hier also sagt, ist keine Durchhalteparole. Es ist eine Verortung. Du wirst bedrängt werden. Aber du bist nicht verloren. Denn der Ort deines Friedens liegt nicht außerhalb der Bedrohung, sondern tiefer. Unter ihr. Und dieser Ort ist eine Person. Christus selbst.
Der Theologe Jürgen Moltmann – oft dialektisch, manchmal sperrig – hat einmal gesagt: „Der gekreuzigte Christus ist der Bruder der Getrennten, der Verlassenen, der Unterdrückten.“ Auch wenn ich theologisch nicht alles unterschreiben würde, spürt man in diesem Satz etwas Echtes: Christus begegnet uns nicht erst im Sieg, sondern in der Tiefe. Und wenn er sagt: „Seid getrost“, dann ist das kein Aufruf zur Selbstermutigung, sondern eine Erinnerung: Du bist nicht allein im Ringen.
In der adventistischen Theologie hat dieser Gedanke ein besonderes Gewicht. Der Sieg Jesu ist nicht nur historisch, sondern eschatologisch relevant. Er ist nicht nur „gewesen“, sondern bleibt gültig – gerade auch mit Blick auf das, was noch kommt. Offenbarung 3,21 macht das deutlich: „Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen.“ Der Überwinder ruft zur Überwindung – nicht aus eigener Kraft, sondern im Glauben an den, der schon überwunden hat (vgl. 1. Johannes 5,4–5).
Das ist keine Einladung zum geistlichen Hochleistungssport, sondern zur bleibenden Verbundenheit. Und das ist vielleicht das Überraschendste an diesem Vers: Nicht wir müssen die Welt besiegen – sondern glauben, dass sie es schon ist. In ihm. Und dann fangen wir an, anders zu leben – nicht weltfremd, sondern weltdurchdrungen vom Frieden, der nicht erklärt werden kann, nur erfahren.
Und genau da führt uns der nächste Schritt hin: zur praktischen Frage, wie dieser Text nicht nur verstanden, sondern gelebt werden kann – durch die Linse von Sin, Promise, Action, Command und Example. Lass uns weitergehen.
Die SPACE-Anwendung*
Die SPACE-Anwendung ist eine Methode, um biblische Texte praktisch auf das tägliche Leben anzuwenden. Sie besteht aus fünf Schritten, die jeweils durch die Anfangsbuchstaben von „SPACE“ repräsentiert werden:
S – Sünde (Sin)
Mal wieder begegnet uns nicht die klassische Sünde im moralischen Sinne, sondern eine viel stillere, aber nicht minder wirksame Form: das Misstrauen gegenüber der Güte und Souveränität Gottes. Wenn Jesus sagt, „In mir habt ihr Frieden“, dann steht dahinter die Einladung zu vertrauen – nicht nur an guten Tagen, sondern besonders dann, wenn es eng wird. Und genau da hakt es oft. Wir rutschen ab in Selbstschutz, Kontrollzwang, Verzweiflung – nicht immer laut, aber innerlich deutlich. Die Sünde, die hier mitschwingt, ist die Versuchung, der Welt mehr Gewicht zu geben als dem Wort Jesu. Das bedeutet nicht, dass Angst oder Schmerz falsch wären. Aber wenn sie zur letztbestimmenden Realität werden, dann verlieren wir den inneren Ort, in dem Frieden wachsen kann.
P – Verheißung (Promise)
Die Verheißung ist klar und leise zugleich: „In mir habt ihr Frieden.“ Nicht du wirst Frieden erarbeiten. Nicht die Umstände werden sich beruhigen. Sondern in mir – sagt Jesus. Das ist kein magischer Schutzschild, sondern eine neue geistliche Verortung. Du darfst wissen: Es gibt einen Ort, der nicht von Bedrängnis verschlungen wird. Einen inneren Raum, der nicht kippt, auch wenn draußen alles wackelt. Und dieser Raum ist kein Zustand, sondern eine Beziehung. Wer in Christus bleibt, bleibt in einem Frieden, der die Welt nicht versteht – aber braucht (vgl. Phil 4,7). Der Text verheißt nicht das Ende der Bedrängnis, sondern das Bleiben des Friedens mitten darin.
A – Aktion (Action)
Wenn du diesen Text ernst nimmst, dann führt er dich nicht zuerst zu Taten – sondern zu einem Perspektivwechsel. Was wäre, wenn Bedrängnis kein Zeichen von Scheitern ist – sondern von Nähe? Wenn nicht du gegen die Welt kämpfen musst, sondern der, der sie längst überwunden hat, dich durchträgt? Das verändert, wie du auf deine Situation schaust. Vielleicht ist der erste Schritt nicht, etwas zu tun, sondern dich neu zu verorten. In ihm. Nicht in deinen Sorgen. Nicht in der Meinung anderer. Nicht mal in deinem Gefühl. Sondern in der Tatsache, dass Christus gesiegt hat – und du in ihm bist.
Und dann – im zweiten Schritt – darf das, was in dir wächst, auch nach außen treten. Vielleicht bedeutet das, dass du dir eine konkrete Bedrängnis nimmst und bewusst sagst: „Ich werde mich nicht mehr von ihr definieren lassen.“ Nicht indem du sie ignorierst, sondern indem du ihr einen anderen Platz gibst: nicht mehr Mittelpunkt, sondern Randnotiz. Und dafür braucht’s manchmal kein großes Glaubensbekenntnis – nur ein stilles „Jesus, erinnere mich daran, dass du größer bist.“ Manchmal ist das schon genug.
C – Appell (Command)
„Seid getrost“ – θαρσεῖτε (tharseite). Der Imperativ steht da, ja. Aber nicht wie ein erhobener Zeigefinger. Eher wie eine ausgestreckte Hand. Jesus sagt das zu Menschen, die gleich davonlaufen werden. Und trotzdem ruft er ihnen zu: Mut! Nicht, weil sie es schon draufhaben. Sondern weil er sie nicht fallen lässt. Der Appell ist also nicht: „Werde stark“, sondern: „Bleib nah.“ Mut ist in diesem Text nicht die Leistung der Tapferen, sondern das Vertrauen der Gehaltenen. Im Alltag könnte das heißen: Du darfst dich innerlich aufrichten – nicht aus eigener Kraft, sondern weil dir jemand sagt: Du musst das nicht allein schaffen. Ich bin da.
E – Beispiel (Example)
Petrus ist ein klassisches Gegenbeispiel. Er hört all das, ist überzeugt, dass er bereit ist – und dann kommt die Bedrängnis. Und er weicht aus, weicht zurück, verleugnet. Nicht weil er böse ist, sondern weil er überfordert ist. Die Angst war lauter als das Vertrauen. Und doch: Jesus bricht nicht mit ihm. Er sucht ihn wieder auf, fragt ihn dreimal, ob er ihn liebt. Und Petrus wird später genau der, der mutig predigt – nicht, weil er keine Angst mehr hat, sondern weil er weiß, was Vergebung bedeutet.
Ein positives Beispiel? Paulus in 2. Korinther 4. Bedrängt, aber nicht erdrückt. Ratlos, aber nicht verzweifelt. Verfolgt, aber nicht verlassen. Paulus lebt aus dem Wissen: Der Sieg Christi trägt selbst da, wo ich schwach bin. Nicht seine Stärke macht ihn zum Überwinder – sondern das Vertrauen in den, der gesagt hat: „Ich habe die Welt überwunden.“
Und genau hier führt uns der nächste Schritt hin: zur persönlichen Identifikation mit dem Text. Was will dieser Vers mir sagen? Was sagt er nicht? Warum trifft er mein Leben – und wie kann ich beginnen, das Gehörte zu leben, glauben, tragen? Lass uns gemeinsam weiterdenken.
Persönliche Identifikation mit dem Text:
In diesem Schritt stelle ich mir sogenannte „W“ Fragen: „Was möchte der Text mir sagen?“ in der suche nach der Hauptbotschaft. Dann überlege ich, „Was sagt der Text nicht?“ um Missverständnisse zu vermeiden. Ich reflektiere, „Warum ist dieser Text für mich wichtig?“ um seine Relevanz für mein Leben zu erkennen. Anschließend frage ich mich, „Wie kann ich den Text in meinem Alltag umsetzen/anwenden?“ um praktische Anwendungsmöglichkeiten zu finden. Weiterhin denke ich darüber nach, „Wie wirkt sich der Text auf meinen Glauben aus?“ um zu sehen, wie er meinen Glauben stärkt oder herausfordert. Schließlich frage ich, „Welche Schlussfolgerungen kann ich für mich aus dem Gesagten ziehen?“ um konkrete Handlungen und Einstellungen abzuleiten.
Ich lese diesen Satz: „In der Welt habt ihr Bedrängnis; aber seid getrost – ich habe die Welt überwunden.“ Und irgendetwas in mir wird still. Nicht, weil ich ihn zum ersten Mal lese. Sondern weil ich ihn diesmal nicht weglesen kann. Ich kenne das: Sätze, die man als Pastor kennt, erklärt hat, zitiert, vielleicht sogar gepredigt – und dann kommt ein Moment, in dem so ein Satz nicht mehr durch mich durchläuft, sondern in mir landet.
Ich weiß nicht, ob du das kennst. Man liest – und während man liest, taucht ein alter Gedanke auf. So ein früher-Gedanke. Bei mir ist es der: „Frieden ist die Belohnung für die, die stark genug durchhalten.“ Ich hab das nie so formuliert. Aber so gelebt? Auf jeden Fall.
Damals war mein Glaube ein Werkzeug. Um die Welt zu verändern. Um Gutes zu tun. Um zu zeigen, dass man auch mit Gott Erfolg haben kann. Alles nicht falsch an sich… Aber ich dachte, Gott würde meinen Einsatz segnen – und ich würde mit dem Segen die Welt gerechter machen. Was ich nicht merkte: Ich rannte. Immer. Und der Friede rannte hinterher.
Heute weiß ich: Der Friede kommt nicht, wenn ich alles im Griff habe. Er kommt, wenn ich aufhöre, alles kontrollieren zu wollen. Jesus sagt: „In mir habt ihr Frieden.“ Nicht: „Wenn ihr’s kapiert habt.“ Nicht: „Wenn ihr stark genug glaubt.“ Einfach: In mir.
Und ich frage mich, ob ich das wirklich glaube. Heute. Jetzt.
Ich weiß, was Bedrängnis ist. Und ich meine nicht die große, dramatische Bedrängnis die es leider oft genug gibt. Sondern die stille Bedrängnis. Die, die dich morgens mit einem Druck auf der Brust aufwachen lässt, obwohl alles äußerlich okay ist. Diese θλῖψις – das griechische Wort – hat mich lange begleitet. Mehr als mir lieb war. Ich hab alles probiert: Strategien, Disziplin, Optimierung. Aber nichts davon war Friede. Frieden ist kein Produkt, kein Zustand. Frieden ist eine Person.
Und trotzdem vergesse ich das. Immer wieder. Ich lese den Text – und während ich lese, will ich schon weiter. Weiterdenken. Planen. Tun. Und dann hält mich dieser Satz fest: „Ich habe die Welt überwunden.“ Ich stocke. Weil ich merke: Das ist nicht mein Sieg. Das ist seiner. Und ich bin eingeladen, in einem bereits geschehenen Sieg zu leben. Nicht zu kämpfen. Nicht zu beweisen. Einfach zu bleiben.
Aber genau das fällt mir schwer. Vielleicht dir auch. Vielleicht sind deine Kämpfe andere, aber das Gefühl, dass du längst Frieden brauchst und ihn dir nicht erlaubst – vielleicht kennst du das. Wenn ja, bleib noch einen Moment.
Denn das, was mich jedes Mal neu trifft, ist: Jesus sagt das nicht nach dem Kreuz. Er sagt es vorher. Mitten in der Nacht. Mitten in der Ahnung, dass alles auseinanderfallen wird. Und das heißt: Friede ist kein Nachher. Friede ist ein Jetzt. Mitten in der Bedrängnis. Mitten in deinem echten, nicht aufgeräumten Leben.
Was das für meinen Alltag bedeutet? Vielleicht, dass ich nicht mehr immer der sein muss, der funktioniert. Nicht der, der Antworten hat. Nicht der, der weiß. Vielleicht darf ich einfach sagen: Ich weiß grad nicht. Ich fühl’s nicht. Ich wackel. Und genau da spricht Jesus: „Sei getrost.“ Nicht als Befehl. Eher wie ein Flüstern.
Ich schreibe das hier nicht, weil ich’s im Griff habe. Ich schreibe es, weil ich’s hören muss. Weil ich so oft innerlich noch auf Bedrängnis reagiere – nicht mit Vertrauen, sondern mit Aktionismus. Vielleicht ist genau das die Einladung: Nicht sofort handeln. Erst mal bleiben. Atmen. Nicht aufgeben, aber auch nicht retten wollen. Nur glauben: Ich bin nicht allein.
Wenn du bis hierher gelesen hast, bist du vermutlich jemand, der gerade auch nicht einfach funktioniert. Vielleicht trägst du viel. Vielleicht denkst du, du solltest… solltest… Und vielleicht brauchst du gerade nicht den nächsten Plan. Sondern eine Pause. Nicht vor dem Frieden. Eine Pause im Frieden.
Ich weiß nicht, was dich gerade bedrängt. Aber ich weiß, dass dieser Text mehr sein kann als ein Vers. Er kann ein Ort sein. Ein innerer Ort, an den du zurückkehren kannst, wenn’s eng wird. Kein Zauberspruch. Kein Schutzschild. Aber ein stilles: Ich weiß, wo ich hingehöre.
Und vielleicht ist das schon genug. Für heute. Für jetzt. Für dich. Für mich.
Morgen? Morgen ein neuer Text. Aber für heute bleibt: „Ich habe die Welt überwunden.“
Und das reicht.
Zentrale Punkte der Ausarbeitung
- Jesu Friede ist nicht an Umstände gebunden.
- Jesus spricht von Bedrängnis – nicht als Möglichkeit, sondern als Realität. Er verspricht keinen Ausweg, sondern eine andere Art zu bleiben.
- Der Friede Jesu kommt nicht nach dem Sieg, sondern mitten im Schmerz – vor Gethsemane, vor dem Schrei. Und das verändert die Perspektive: Friede ist kein Ergebnis, sondern ein Geschenk.
- Der Moment, in dem Jesus spricht, ist entscheidend.
- Wir überlesen oft wann Jesus diesen Satz sagt. Aber das ist der Clou: Er sagt ihn nicht am leeren Grab, sondern im Schatten des Kreuzes.
- Der eigentliche Sieg beginnt nicht mit der Auferstehung – sondern mit dem Vertrauen vor dem Leiden. Das macht den Glauben tragfähig in echten Krisen.
- Zwischen den Worten liegt Tiefe.
- Der Text lebt nicht nur von seiner Botschaft, sondern von seinem Ton. Zwischen den Zeilen klingt ein leises „Ich bin da“ – ohne Lautstärke, aber mit Gewicht.
- Es geht nicht nur um das Gesagte, sondern um die Haltung dahinter: Vertrauen mitten im Dunkel. Hoffnung, ohne dass man sie schon sieht.
- Alltag und Theologie gehören zusammen.
- Der Impuls startet nicht in einem theologischen Lehrraum, sondern am Spiegel beim Zähneputzen.
- Genau da begegnet dir der Friede Christi – nicht im Rückzug, sondern in Routinen, die offen werden für Präsenz.
- Der Alltag wird zum Ort der Erinnerung, dass du nicht allein lebst, sondern mit einem, der überwunden hat – längst, und auch für dich.
- Ostern ist nicht die Ausnahme – sondern der Anker.
- Der Impuls endet nicht mit einer Lehre, sondern mit einer Haltung: „Ich lebe mit jemandem, der die Welt längst überwunden hat.“
- Und ist es nicht genau das, was wir heute feiern? – Diese rhetorische Rückbindung macht aus dem Text keinen Gedanken, sondern ein Bekenntnis.
Warum ist das wichtig für mich?
- Es entlastet mich.
- Ich muss nicht so tun, als sei Friede die Folge von Glaubensstärke. Der Friede kommt mitten im Zweifel. Das gibt mir Raum, echt zu bleiben – auch als Theologe, Pastor, Vater, Ehemann, Mensch.
- Es verändert meine Perspektive auf das Jetzt.
- Ich muss nicht warten, bis etwas vorbei ist, um innerlich ruhig zu werden. Jesus spricht seinen Satz vor der Krise – also darf ich auch mitten im Chaos wissen: Ich bin gehalten.
- Es verbindet meine Spiritualität mit meinem Alltag.
- Der Impuls beginnt nicht im Gebetshaus, sondern im Badezimmer. Das ist keine Banalisierung, sondern eine Verankerung. Ich darf Gott im Alltäglichen erwarten – ehrlich, unaufgeregt, aber echt.
- Es macht mein Gottesbild reifer.
- Jesus ist nicht nur der Sieger – er ist der Getragene, der Vertrauende, der Mit-Leidende. Das macht es mir möglich, nicht nur an ihn zu glauben, sondern mit ihm zu leben.
Der Mehrwert dieser Erkenntnis
- Ich kann aufhören, Frieden als Belohnung zu denken, und anfangen, ihn als Gegenwart zu empfangen.
- Ich kann ehrlicher mit meinen Grenzen sein, weil Jesus seinen Sieg nicht nach dem Überwinden, sondern vor dem Leid ausgesprochen hat.
- Ich kann meinen Glauben nicht nur predigen, sondern verkörpern – weil er in meinen Routinen greifbar wird, nicht nur in meinen Gedanken.
- Ich kann meine Theologie in leise Gesten verwandeln – in ein Zwinkern vor dem Spiegel, in ein Innehalten im Lärm, in ein innerliches „Stimmt ja“ mitten im Leben.
Kurz gesagt: Wenn Jesus seinen Sieg vor dem Leid ausgesprochen hat, dann bedeutet das:
Mein Friede hängt nicht daran, ob ich durch bin – sondern daran, wer mit mir durchgeht.
Und das ist vielleicht das österlichste Geschenk überhaupt.
*Die SPACE-Analyse im Detail:
Sünde (Sin): In diesem Schritt überlegst du, ob der Bibeltext eine spezifische Sünde aufzeigt, vor der du dich hüten solltest. Es geht darum, persönliche Fehler oder falsche Verhaltensweisen zu erkennen, die der Text anspricht. Sprich, Sünde, wird hier als Verfehlung gegenüber den „Lebens fördernden Standards“ definiert.
Verheißung (Promise): Hier suchst du nach Verheißungen in dem Text. Das können Zusagen Gottes sein, die dir Mut, Hoffnung oder Trost geben. Diese Verheißungen sind Erinnerungen an Gottes Charakter und seine treue Fürsorge.
Aktion (Action): Dieser Teil betrachtet, welche Handlungen oder Verhaltensänderungen der Text vorschlägt. Es geht um konkrete Schritte, die du unternehmen kannst, um deinen Glauben in die Tat umzusetzen.
Appell (Command): Hier identifizierst du, ob es in dem Text ein direktes Gebot oder eine Aufforderung gibt, die Gott an seine Leser richtet. Dieser Schritt hilft dir, Gottes Willen für dein Leben besser zu verstehen.
Beispiel (Example): Schließlich suchst du nach Beispielen im Text, die du nachahmen (oder manchmal auch vermeiden) solltest. Das können Handlungen oder Charaktereigenschaften von Personen in der Bibel sein, die als Vorbild dienen.
Diese Methode hilft dabei, die Bibel nicht nur als historisches oder spirituelles Dokument zu lesen, sondern sie auch praktisch und persönlich anzuwenden. Sie dient dazu, das Wort Gottes lebendig und relevant im Alltag zu machen.