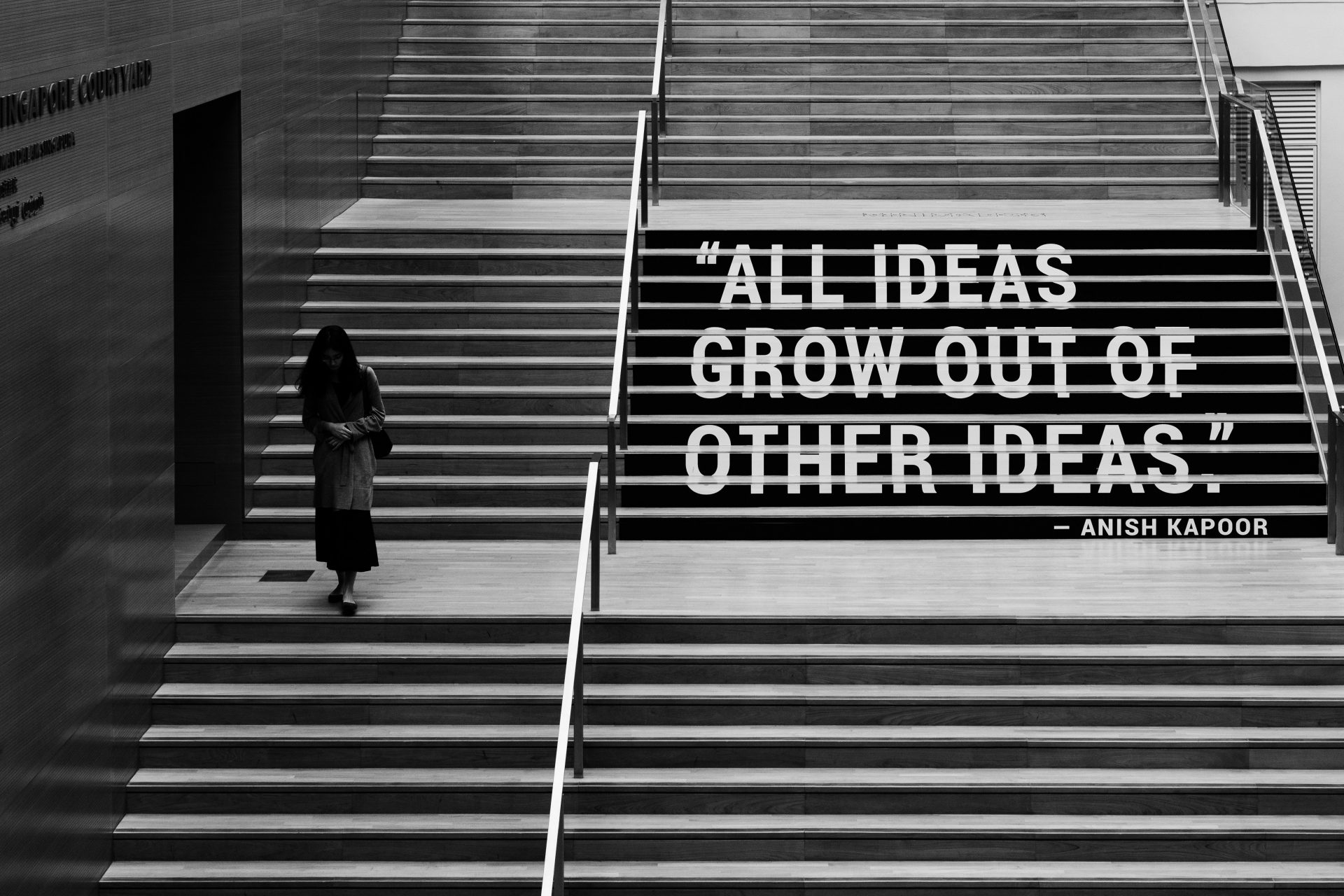Fettgedrucktes für schnell Leser…
Einleitender Impuls:
Es gibt Entscheidungen, die treffen wir bewusst – und dann gibt es die, die sich einfach einschleichen. Die, die wir gar nicht richtig bemerken, weil sie nicht als große Weggabelung daherkommen, sondern als tägliche Kleinigkeiten. Ein Wort, das wir übernehmen. Eine Haltung, die wir uns aneignen. Eine Denkweise, die sich still in uns einnistet. Nicht weil wir wollten, sondern weil es „normal“ war. Genau hier setzt der Impuls an: Woran orientierst du dich eigentlich? Und merkst du es überhaupt?
Denn wir Menschen übernehmen mehr, als wir denken. Wir lassen uns formen – von den Menschen um uns herum, von dem, was wir sehen, hören, glauben. Die Frage ist nur: Was färbt auf dich ab? Johannes bringt es in seinem Brief zwischen den Zeilen auf den Punkt: Böses aufzunehmen, geht schnell. Das Gute zu wählen, braucht eine bewusste Entscheidung. Und diese Entscheidung zeigt sich nicht in großen Heldentaten, sondern im Kleinen – in deiner Haltung, in deiner Sprache, in dem, was du weiterträgst. Bist du jemand, bei dem andere aufatmen? Oder jemand, der nur das reproduziert, was gerade passiert?
Und ja, das ist unbequem. Denn es bedeutet, dass du manchmal gegen den Strom schwimmen musst. Dass du vielleicht nicht mitlachst, wenn über jemanden gelästert wird. Dass du vielleicht als kompliziert giltst, weil du nicht mitmachst, wenn sich alle über die gleiche Sache aufregen. Aber es bedeutet auch, dass du ein Mensch sein kannst, der nicht einfach nur reagiert, sondern aktiv etwas Positives hineinbringt. Einer, der etwas trägt, das die Welt nicht einfach so hervorbringt: echte Güte. Und die verändert mehr, als du ahnst.
Also, wo stehst du? Welche Einflüsse formst du? Und was lässt du in dein Leben rein? Vielleicht ist es Zeit für einen ehrlichen Blick. Denn das, was auf dich abfärbt, wird irgendwann zu dem, was du bist.
Fragen zur Vertiefung oder für Gruppengespräche:
- Was sind die Einflüsse in deinem Leben, die dich prägen – bewusst oder unbewusst?
- In welchen Bereichen merkst du, dass du vielleicht mehr „mitläufst“, als dir lieb ist?
- Was wäre eine bewusste Entscheidung, die du diese Woche treffen könntest, um aktiver das Gute zu wählen?
Parallele Bibeltexte als Slogans:
Römer 12:2 — „Passt euch nicht diesem Zeitgeist an, sondern lasst euch verwandeln“
1. Korinther 15:33 — „Schlechte Gesellschaft verdirbt gute Sitten“
Psalm 1:1-2 — „Glücklich ist, wer sich am Gesetz des Herrn orientiert, nicht am Rat der Gottlosen“
Philipper 4:8 — „Denkt über das nach, was gut, edel und lobenswert ist“
Wenn du wissen willst, warum das, was dich prägt, dich mehr verändert, als du denkst – und wie du das bewusst gestalten kannst, dann nimm dir 20 Minuten Zeit und lass uns gemeinsam tiefer gehen!
Die Informationen für den Impuls hole ich mir meistens aus BibleHub.com damit auch du es nachschlagen kannst.
Schön, dass wir uns heute gemeinsam auf diese Reise begeben! Bevor wir in 3. Johannes 1,11 eintauchen, lass uns die Betrachtung mit einem Gebet beginnen:
Lieber Vater, Danke, dass Du uns immer wieder Wege aufzeigst, die zu Dir führen. In einer Welt, in der das Gute und das Schlechte oft ineinanderfließen, brauchen wir Deine Weisheit, um klar zu erkennen, was von Dir kommt. Hilf uns, nicht nur das Richtige zu erkennen, sondern es auch mutig zu leben. Lass uns das Gute nicht nur bewundern, sondern aktiv danach streben – denn wer Gutes tut, zeigt, dass er Dich kennt. Öffne unser Herz für Deine Wahrheit, damit wir durch Dein Wort verändert werden.
In Jesu Namen beten wir,
Amen.
Der Text:
Zunächst werfen wir einen Blick auf den Text in verschiedenen Bibelübersetzungen. Dadurch gewinnen wir ein tieferes Verständnis und können die unterschiedlichen Nuancen des Textes in den jeweiligen Übersetzungen oder Übertragungen besser erfassen. Dazu vergleichen wir die Elberfelder 2006 (ELB 2006), Schlachter 2000 (SLT), Luther 2017 (LU17), Basis Bibel (BB) und die Hoffnung für alle 2015 (Hfa).
3 . Johannes 11
ELB 2006 Geliebter, ahme nicht das Böse nach, sondern das Gute! Wer Gutes tut, ist aus Gott; wer Böses tut, hat Gott nicht gesehen.
SLT Mein Lieber, ahme nicht das Böse nach, sondern das Gute! Wer Gutes tut, der ist aus Gott; wer aber Böses tut, der hat Gott nicht gesehen.
LU17 Mein Lieber, nimm nicht das Böse zum Vorbild, sondern das Gute. Wer Gutes tut, der ist von Gott; wer Böses tut, der hat Gott nicht gesehen.
BB Mein Lieber, nimm dir kein Beispiel am Bösen, sondern am Guten. Wer Gutes tut, stammt von Gott. Wer Böses tut, hat Gott niemals gesehen.
HfA Doch du, mein lieber Freund, sollst diesem schlechten Beispiel nicht folgen, sondern dem guten. Denn nur wer das Gute tut, ist ein Kind Gottes. Wer das Böse tut, kennt Gott nicht.
Der Kontext:
In diesem Abschnitt geht es darum, die grundlegenden Fragen – das „Wer“, „Wo“, „Was“, „Wann“ und „Warum“ – zu klären. Das Ziel ist es, ein besseres Bild von der Welt und den Umständen zu zeichnen, in denen dieser Vers verfasst wurde. So bekommen wir ein tieferes Verständnis für die Botschaft, bevor wir uns den Details widmen.
Kurzgesagt… Der 3. Johannesbrief ist eine persönliche Nachricht von einem alten, erfahrenen Leiter an einen jüngeren Freund in der Gemeinde. Es geht um ein simples, aber entscheidendes Prinzip: Tu das Gute, nicht das Böse. Doch hinter diesen wenigen Worten steckt eine tiefere Spannung – denn nicht alle in der Gemeinde leben das, was sie predigen.
Previously on… Wir befinden uns in einer Zeit, in der das Christentum nicht mehr nur eine kleine, jüdische Bewegung ist, sondern sich bereits über das Römische Reich ausbreitet. Doch mit dem Wachstum kommen auch Herausforderungen: Machtspiele, falsche Lehren und Streitigkeiten um Einfluss. Johannes, der vermutlich letzte noch lebende Apostel, schreibt diesen Brief nicht an eine ganze Gemeinde, sondern direkt an einen Mann namens Gaius – einen treuen Christen, der für seine Gastfreundschaft und seine Unterstützung von reisenden Missionaren bekannt ist. Doch nicht alle in der Gemeinde sind so wohlgesinnt. Da gibt es Diotrephes, einen Mann mit Einfluss, der sich offenbar für den Chef hält, andere unterdrückt und sogar echte Apostel ablehnt. Kurz gesagt: Gaius steht mitten in einem Machtkampf.
Johannes schreibt diesen Brief also nicht nur, um Gaius zu ermutigen, sondern auch um klarzustellen, wer hier eigentlich das Richtige tut. Der Apostel setzt eine klare Linie zwischen denen, die Gutes tun (und damit zu Gott gehören), und denen, die ihre eigene Machtposition sichern wollen – und sich damit gegen Gott stellen. Es ist ein dringender Appell, nicht auf die Falschen hereinzufallen, sondern sich bewusst an denen zu orientieren, die wirklich im Geist Christi handeln.
In diesem Kontext fällt unser Vers 3. Johannes 1,11: „Mein Lieber, folge nicht dem Bösen nach, sondern dem Guten. Wer Gutes tut, der ist aus Gott; wer Böses tut, der hat Gott nicht gesehen.“ Dieser Satz ist nicht nur ein allgemeiner moralischer Ratschlag, sondern ein direkter Hinweis auf die Situation in der Gemeinde. Gaius muss sich entscheiden: Hält er an seinem Dienst der Liebe fest oder lässt er sich von den Einschüchterungen eines selbstherrlichen Leiters beeinflussen?
Und genau hier setzt unsere Reise an. Was bedeutet es eigentlich, dem Guten zu folgen? Und warum ist das so ein entscheidender Marker für die Zugehörigkeit zu Gott? Die Antworten liegen in den Schlüsselwörtern des Textes – und genau da steigen wir jetzt ein.
Die Schlüsselwörter:
In diesem Abschnitt wollen wir uns genauer mit den Schlüsselwörtern aus dem Text befassen. Diese Worte tragen tiefere Bedeutungen, die oft in der Übersetzung verloren gehen oder nicht auf den ersten Blick ersichtlich sind. Wir werden die wichtigsten Begriffe aus dem ursprünglichen Text herausnehmen und ihre Bedeutung näher betrachten. Dabei schauen wir nicht nur auf die wörtliche Übersetzung, sondern auch darauf, was sie für das Leben und den Glauben bedeuten. Das hilft uns, die Tiefe und Kraft dieses Verses besser zu verstehen und ihn auf eine neue Weise zu erleben.
3. Johannes 1,11 – Ursprünglicher Text (Nestle-Aland 28):
Ἀγαπητέ, μὴ μιμοῦ τὸ κακὸν ἀλλὰ τὸ ἀγαθόν. ὁ ἀγαθοποιῶν ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστιν· ὁ κακοποιῶν οὐχ ἑώρακεν τὸν θεόν.
Übersetzung 3. Johannes 1,11 (Elberfelder 2006):
„Geliebter, ahme nicht das Böse nach, sondern das Gute! Wer Gutes tut, ist aus Gott; wer Böses tut, hat Gott nicht gesehen.“
Semantisch-pragmatische Kommentierung der Schlüsselwörter
- Ἀγαπητέ (Agapēte) – „Geliebter“: Ein starker Einstieg! Johannes spricht Gaius mit Agapēte an – nicht nur ein Freundschaftsgruß, sondern eine tiefe, herzliche Anrede. Agapētos wird im Neuen Testament oft für Menschen verwendet, die in einer besonderen Beziehung zu Gott stehen. Hier schwingt nicht nur Zuneigung, sondern auch ein gewisses Maß an Verantwortung mit. Ein „Geliebter“ im geistlichen Sinne ist jemand, der bereits Teil des Guten ist – die Frage ist nur: Lebt er es auch?
- Μιμοῦ (Mimou) – „Ahme nach“: Klingt simpel, ist aber eine gewaltige Aufforderung. Mimeomai bedeutet nicht nur „jemanden kopieren“, sondern sich aktiv an einem Vorbild orientieren, um es in das eigene Leben zu integrieren. Es geht nicht um bloßes Nachspielen, sondern um ein bewusstes Lernen und Einüben. In der Antike wurde der Begriff oft für Schüler eines Meisters verwendet, die sich dessen Verhalten anpassten. Johannes sagt hier also: Wähle bewusst, wem du nacheiferst – denn das macht dich aus.
- Κακὸν (Kakon) – „Böses“: Hier wird es brisant. Kakos bedeutet mehr als nur „schlecht“ oder „nicht optimal“. Es beschreibt eine tiefe moralische Verderbtheit, etwas, das seinem Wesen nach destruktiv ist. In der griechischen Philosophie wurde kakon oft mit einem verfehlten oder verrotteten Zustand verbunden – also etwas, das nicht nur schadet, sondern auch korrumpiert. Johannes fordert hier nicht einfach zu moralischem Verhalten auf, sondern zu einer bewussten Entscheidung gegen das, was das geistliche Leben zersetzt.
- Ἀγαθόν (Agathon) – „Gutes“: Das Gegenstück zu kakon – und weit mehr als nur „nett sein“. Agathos beschreibt das moralisch Vollkommene, das, was in Gottes Augen wertvoll ist. Im klassischen Griechisch wurde agathon oft als Synonym für Tugend, Integrität und göttliche Güte verwendet. Johannes stellt also klar: Gut ist nicht nur das Gegenteil von Böse – es ist das, was mit Gott in Verbindung steht.
- Ἀγαθοποιῶν (Agathopoiōn) – „Gutes tun“: Jetzt wird es praktisch. Agathopoieō ist ein dynamisches Wort – es bedeutet nicht nur, gut zu sein, sondern aktiv Gutes zu tun, Gerechtigkeit zu fördern, andere zu segnen. Das ist der entscheidende Punkt: Güte ist kein Konzept, sondern eine Lebensweise. Johannes sagt nicht: „Sei gut“, sondern „Handle gut.“
- Θεοῦ (Theou) – „Gott“: Theos taucht hier in der Genitivform auf, was eine Herkunftsbezeichnung andeutet. Wer Gutes tut, ist nicht nur „von Gott beeinflusst“, sondern „aus Gott“ – er gehört ihm, kommt von ihm, trägt sein Wesen in sich. Das ist eine starke theologische Aussage: Taten offenbaren die Quelle eines Menschen.
- Κακοποιῶν (Kakopoiōn) – „Böses tun“: Das böse Gegenstück zu Agathopoieō. Kakopoieō bedeutet nicht nur, einen Fehler zu machen, sondern bewusst destruktiv zu handeln. Während „Kakon“ einen Zustand beschreibt, geht es hier um eine aktive Handlung – die bewusste Entscheidung für das Falsche. Das macht die Schärfe von Johannes’ Worten deutlich: Wer Böses tut, trennt sich aktiv von Gott.
- Ἑώρακεν (Heōraken) – „Hat nicht gesehen“: Das Finale – und es hat es in sich. Heōraken kommt von horaō, was mehr bedeutet als nur „sehen“. Es meint eine tiefgehende, erfahrungsbasierte Erkenntnis. Wer Gutes tut, hat Gott nicht nur verstanden, sondern ihn wirklich „gesehen“ – im Sinne von geistlicher Einsicht. Wer Böses tut, hat Gott dagegen nie wirklich erkannt. Das ist eine radikale Aussage: Es geht nicht nur darum, ob jemand an Gott glaubt, sondern ob sein Leben zeigt, dass er Gott wirklich kennt.
Johannes malt hier ein klares Bild: Unser Handeln ist nicht nur Ausdruck unseres Charakters – es ist ein direkter Hinweis darauf, ob wir Gott wirklich erkannt haben oder nicht. Wer Gutes tut, zeigt, dass er von Gott beeinflusst ist. Wer Böses tut, hat keine Ahnung, wer Gott wirklich ist. Das ist keine bloße moralische Einschätzung – es ist ein geistliches Diagnoseinstrument.
Und genau an diesem Punkt setzen wir jetzt an: Was bedeutet das theologisch? Was sagt uns dieser Vers über unser Gottesbild, unseren Glauben und die Art und Weise, wie wir als Christen leben?
Ein Kommentar zum Text:
Es gibt Verse, die einfach sitzen. 3. Johannes 1,11 ist so einer. Er ist kurz, klar und kompromisslos: „Ahme nicht das Böse nach, sondern das Gute.“ Klingt fast zu simpel, oder? Wer Gutes tut, gehört zu Gott. Wer Böses tut, hat Gott nicht einmal gesehen. Aber halt! Ist das nicht ein bisschen hart? Heißt das, wenn jemand mal einen schlechten Tag hat oder einen Fehler macht, hat er Gott nie gesehen? Und wie kann Johannes das so sicher sagen? Willkommen zur theologischen Tiefenanalyse – wir graben jetzt bis zum Fundament.
Beginnen wir mit der Wurzel der Aussage. Johannes ist nicht nur nett zu Gaius – er setzt eine theologische Grundlinie. Er formuliert den Satz fast wie ein Axiom: Gutes tun kommt aus Gott. Böses tun ist ein Zeichen der Entfremdung von Gott. Aber was bedeutet „Gutes tun“? Hier steckt mehr dahinter als „Sei ein netter Mensch“. Das griechische Wort ἀγαθοποιῶν (agathopoión) beschreibt nicht nur eine Handlung, sondern eine tiefere innere Haltung. Es geht um eine Art von Güte, die aus einer Gott-verbundenen Identität fließt. Nicht einfach moralisch korrekt sein, sondern aktiv das Gute verkörpern – so wie Jesus. Klingt herausfordernd? Ist es auch.
Das Gegenstück dazu ist κακοποιῶν (kakopoión), „Böses tun“. Interessanterweise nutzt Johannes hier eine aktive Form. Es geht nicht um gelegentliche Fehler oder Schwächen – es geht um ein Lebensmuster. Dieses Wort bezeichnet Menschen, die bewusst und regelmäßig böse handeln. Damit kommen wir zum Kern der theologischen Spannung: Sind wir das, was wir tun? Wenn Johannes sagt, dass der Böse Gott nicht „gesehen“ hat, benutzt er das griechische Wort ἑώρακεν (heōraken), das nicht nur „sehen“ bedeutet, sondern „wirklich erkennen, erfassen, erfahren“. Mit anderen Worten: Johannes argumentiert nicht moralistisch, sondern erkenntnistheologisch. Wer Gott „sieht“, also wirklich erkennt, kann nicht dauerhaft gegen ihn leben. Umgekehrt: Wer konsequent gegen Gottes Prinzipien handelt, zeigt, dass er ihn nie wirklich erkannt hat.
Das wirft eine Frage auf: Was ist mit Christen, die scheitern? Johannes’ Aussage könnte fast wie ein Schwarz-Weiß-Denken klingen, aber das NT spricht an anderer Stelle eine gewisse Spannung an. Jakobus 3,2 sagt klar: „Wir alle straucheln oft.“ Paulus ringt in Römer 7,19 mit dem Dilemma, dass er zwar das Gute will, aber oft das Böse tut. Also, wie lösen wir das auf? Der Unterschied liegt in der Richtung. Johannes redet nicht über gelegentliche Fehler oder innere Kämpfe. Er spricht von einer bewussten, fortgesetzten Praxis des Bösen. Es ist der Lebensstil, der zeigt, ob jemand wirklich Gott erkannt hat.
Hier kommt ein noch größeres Thema ins Spiel: der Gedanke der „Nachahmung“ (μίμησις, mimēsis). In der antiken Welt war Nachahmung ein zentraler Begriff der Philosophie. Ein Schüler lernte nicht nur durch Theorie, sondern indem er den Lehrer imitierte. Jesus selbst stellte dieses Prinzip auf: „Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen“ (Johannes 14,9). Paulus greift es in 1. Korinther 11,1 auf: „Folgt meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel Christi folge.“ Der Glaube ist also kein theoretisches Konstrukt, sondern ein einzuübender Lebensstil.
Damit ergibt sich eine weitere Schlüsselfrage: Woher kommt die Fähigkeit, das Gute zu tun? Ist es einfach nur Willenskraft? Eine Erziehungsfrage? Das NT beantwortet das klar: Es ist die Verbindung mit Gott. Jesus selbst sagt in Johannes 15,5: „Ohne mich könnt ihr nichts tun.“ Paulus geht in Galater 5,22-23 noch weiter und beschreibt, dass das Gute aus dem „Frucht des Geistes“ entspringt – es ist also ein göttlicher Prozess, kein menschliches Produkt.
Nun bleibt noch ein letzter Punkt: Warum stellt Johannes die Dinge so scharf dar? Die Antwort liegt in der Gemeinde-Situation. Er schreibt diesen Brief an Gaius, während Diotrephes – ein selbstherrlicher Gemeindeleiter – eine toxische Dynamik in der Gemeinde geschaffen hat. Es geht also nicht nur um abstrakte Theologie, sondern um eine reale Bedrohung für den Glauben. Johannes warnt: „Pass auf, wen du nachahmst.“ Das ist auch für uns heute relevant. Unser Umfeld prägt uns mehr, als wir oft denken. Mit wem wir uns umgeben, wen wir bewundern, wessen Verhalten wir übernehmen – das formt unseren Glauben genauso wie unsere Theologie.
Das bedeutet: Gutes zu tun ist keine bloße moralische Entscheidung, sondern eine geistliche Orientierung. Es ist ein Zeichen dafür, dass wir Gott kennen – und wenn wir ihn kennen, können wir gar nicht anders, als ihm ähnlicher zu werden. Und genau hier setzt der nächste Schritt an: Wie lässt sich dieser Text konkret ins Leben integrieren? Die SPACE-Anwendung hilft uns, das herauszufinden.
Die SPACE-Anwendung*
Die SPACE-Anwendung ist eine Methode, um biblische Texte praktisch auf das tägliche Leben anzuwenden. Sie besteht aus fünf Schritten, die jeweils durch die Anfangsbuchstaben von „SPACE“ repräsentiert werden:
S – Sünde (Sin)
Es gibt eine subtile, aber mächtige Gefahr, die Johannes hier anspricht: Nachahmung ohne Reflexion. Klingt harmlos, kann aber fatal sein. Menschen sind soziale Wesen – wir lernen durch Beobachtung, wir passen uns an, oft ohne es zu merken. Doch genau hier liegt das Problem: Nicht alles, was in unserer Umgebung „normal“ ist, ist auch gut. Wenn wir uns unbewusst von negativen Einflüssen prägen lassen, dann wird das Böse salonfähig, und wir bemerken nicht einmal, dass wir längst nicht mehr aus Überzeugung handeln, sondern aus Gewohnheit. Das zeigt sich in vielen Bereichen: Wenn in einer Gruppe ständig gelästert wird, wird es irgendwann normal. Wenn Gier oder Egoismus akzeptiert sind, wird es schwer, dagegen zu stehen. Die Frage ist also nicht nur: „Tue ich Böses?“, sondern: „Von wem lasse ich mich eigentlich prägen?“ Johannes’ Warnung ist klar: Bevor du dich anpasst, überlege, woran du dich orientierst.
P – Verheißung (Promise)
Wer sich am Guten orientiert, ist „aus Gott“. Klingt fast wie eine DNA-Analyse: Du kannst erkennen, wo jemand hingehört, indem du siehst, was er tut. Das ist eine krasse Verheißung, denn sie bedeutet, dass das Gute nicht nur etwas ist, das wir anstreben, sondern etwas, das in uns wachsen kann, wenn wir mit Gott verbunden sind. In Johannes 15,5 sagt Jesus: „Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht.“ Das bedeutet: Es geht nicht um Perfektionismus oder moralische Selbstoptimierung, sondern um eine innere Veränderung durch Gottes Nähe. Und hier liegt die Hoffnung: Wenn du Gott kennst, wird das Gute nicht eine Pflicht, sondern ein natürlicher Ausdruck deiner Identität.
A – Aktion (Action)
Es wäre gut, wenn du dir mal bewusst ansiehst, wen oder was du eigentlich nachahmst. Unser Charakter wird nicht über Nacht geformt, sondern durch die Summe der Menschen, Medien, Ideale und Werte, die uns beeinflussen. Die ersten praktischen Schritte könnten sein: Reflexion und Auswahl. Reflexion bedeutet, dass du dir bewusst machst, welche Stimmen in deinem Leben am lautesten sind. Wessen Meinung beeinflusst dich? Welche Vorbilder prägen dein Denken? Woher kommen deine moralischen Standards? Auswahl bedeutet, dass du ganz aktiv entscheidest, welche Einflüsse du in dein Leben lässt. Johannes fordert Gaius nicht nur auf, sich dem Guten zuzuwenden, sondern dem Bösen aktiv eine Absage zu erteilen. Das bedeutet manchmal, toxische Beziehungen loszulassen, den eigenen Medienkonsum zu überdenken oder sich bewusst mit Menschen zu umgeben, die einen positiv prägen.
Langfristig bedeutet das aber noch mehr: Charakter entsteht durch Gewohnheiten. Wenn du dich fragst, ob du ein guter oder ein schlechter Mensch bist, ist das nicht die richtige Frage. Die bessere Frage ist: Welche kleinen Entscheidungen triffst du täglich, die dich langfristig prägen? Das Gute zu tun, beginnt nicht mit großen Heldentaten, sondern mit alltäglichen Entscheidungen – ein ehrliches Wort, eine großzügige Geste, ein Moment der Integrität. Und weil Johannes hier von „Nachahmung“ spricht, kannst du es dir leicht machen: Suche nach Menschen, die Gutes tun, und orientiere dich an ihnen.
C – Appell (Command)
Mach das Gute zu deiner Gewohnheit! Nicht, weil du musst, sondern weil es sich lohnt. Die Welt braucht Menschen, die das Gute aktiv verkörpern – nicht aus Pflichtgefühl, sondern weil sie verstanden haben, dass Güte ansteckend ist. Johannes stellt keinen komplizierten theologischen Katalog auf, sondern gibt eine einfache Handlungsanweisung: Lass dich nicht vom Bösen mitziehen, sondern entscheide dich für das Gute.
E – Beispiel (Example)
Zwei starke Beispiele aus der Bibel zeigen, wie diese Entscheidung praktisch aussieht. Daniel (Daniel 1,8-20) lebte in einer feindlichen Kultur, aber er entschied sich bewusst, sich nicht an die Werte Babylons anzupassen – mit erstaunlichen Konsequenzen. Barnabas – was übersetzt Sohn des Trostes bedeutet (Apostelgeschichte 4,36-37) wurde zum Inbegriff eines ermutigenden Menschen, weil er sich entschied, das Gute aktiv zu fördern, wo manch andere eventuell nur zusahen. Ich sehe in beiden Männern etwas gemeinsam: Sie orientierten sich nicht an ihrer Umgebung, sondern an dem, was sie in Gott erkannt hatten.
Damit sind wir an einem entscheidenden Punkt: Wie sieht das ganz konkret in deinem persönlichen Leben aus? Welche Situationen, Herausforderungen oder Entscheidungen stehen an, in denen du zwischen „Nachahmen“ und „Neu denken“ wählen kannst? Das ist der nächste Schritt – die persönliche Identifikation mit dem Text.
Persönliche Identifikation mit dem Text:
In diesem Schritt stelle ich mir sogenannte „W“ Fragen: „Was möchte der Text mir sagen?“ in der suche nach der Hauptbotschaft. Dann überlege ich, „Was sagt der Text nicht?“ um Missverständnisse zu vermeiden. Ich reflektiere, „Warum ist dieser Text für mich wichtig?“ um seine Relevanz für mein Leben zu erkennen. Anschließend frage ich mich, „Wie kann ich den Text in meinem Alltag umsetzen/anwenden?“ um praktische Anwendungsmöglichkeiten zu finden. Weiterhin denke ich darüber nach, „Wie wirkt sich der Text auf meinen Glauben aus?“ um zu sehen, wie er meinen Glauben stärkt oder herausfordert. Schließlich frage ich, „Welche Schlussfolgerungen kann ich für mich aus dem Gesagten ziehen?“ um konkrete Handlungen und Einstellungen abzuleiten.
3. Johannes 1,11 klingt erstmal simpel: „Ahme nicht das Böse nach, sondern das Gute.“ Logisch, oder? Keiner würde sagen: „Hey, coole Idee, lass mich mal was Böses ausprobieren.“ Aber dann fängst du an, drüber nachzudenken, und plötzlich wird’s unangenehm. Woran orientiere ich mich eigentlich wirklich? Und merke ich überhaupt, wenn ich vom Kurs abkomme?
Johannes macht hier keine graue Theologie, er trifft uns mitten in der Realität. Wir Menschen sind Nachahmer. Unser ganzes Leben basiert darauf, von anderen zu lernen. Kinder kopieren ihre Eltern, Freundeskreise gleichen sich mit der Zeit an, und selbst Erwachsene lassen sich durch Gesellschaft, Trends und Meinungen mehr beeinflussen, als sie zugeben würden. Die Frage ist nicht, ob du nachahmst – sondern wen. Und genau hier setzt der Text an. Er fordert uns heraus, bewusst zu wählen, wer oder was unser Maßstab ist. Es ist ein Vers über Orientierung, über Identität, über die stillen Einflüsse, die unser Herz formen.
Und jetzt kommt der Punkt, an dem es herausfordernd wird: Der Text sagt nicht, dass Gutes tun einfach ist. Er gibt keine Garantie, dass dir das Gute immer sofort einleuchtet oder dass die Welt dich dafür feiern wird. Ganz im Gegenteil. Johannes schrieb das in einer Situation, in der das Böse in der Gemeinde einen Namen hatte: Diotrephes. Ein Mensch, der aktiv Schaden anrichtete – aus Machtstreben, aus Stolz, aus Unsicherheit? Wer weiß. Und das ist das Erschreckende: Böse zu handeln bedeutet nicht immer, ein offensichtlicher Bösewicht zu sein. Manchmal reicht es, wenn wir einfach mitmachen, stillschweigend zusehen oder nicht widersprechen. Das Böse wächst da, wo keiner bewusst das Gute wählt.
Genau das fordert mich persönlich heraus. Was heißt es, das Gute zu wählen, wenn es nicht bequem ist? Wenn es bedeutet, einem Freund die Wahrheit zu sagen, obwohl er sie nicht hören will? Wenn es bedeutet, gegen den Strom zu schwimmen, weil Integrität manchmal unpopulär ist? Und was ist mit den Momenten, wo ich selbst an mir zweifle – wenn ich unsicher bin, ob ich wirklich das Gute tue, oder ob ich mich nur besser fühlen will? Dieser Text drängt mich dazu, ehrlich hinzuschauen: Nicht alles, was sich gut anfühlt, ist auch gut. Nicht alles, was normal ist, ist auch richtig. Und das bedeutet, dass ich mich entscheiden muss, bevor der Moment kommt.
Was könnte das praktisch heißen? Wen und was lasse ich in mein Leben sprechen? Wen nehme ich mir als Vorbild? Welche Werte prägen meine Entscheidungen – und woher kommen sie eigentlich? Es wäre gut, wenn ich regelmäßig innehalte und reflektiere, statt einfach nur „mitzuschwimmen“. Vielleicht bedeutet das, mich bewusster mit Menschen zu umgeben, die mir guttun. Vielleicht heißt es, nicht jede Meinung auf Social Media als Wahrheit zu nehmen. Vielleicht bedeutet es, mich aktiv in eine Richtung zu entwickeln, anstatt passiv geprägt zu werden.
Am Ende ist dieser Vers nicht einfach eine Regel, sondern eine Einladung: Du darfst aktiv wählen, wer du sein willst. Und das ist der Gamechanger. Es geht nicht darum, perfekt zu sein. Es geht darum, bewusst zu leben. Johannes macht uns klar: Das Gute entsteht nicht von selbst – es wird gewählt. Und genau da liegt die Kraft dieses Textes. Er drängt uns zur Entscheidung. Nicht aus Angst, nicht aus Zwang, sondern weil das, was wir heute nachahmen, bestimmt, wer wir morgen sind. Also, was wird deine Wahl sein?
*Die SPACE-Analyse im Detail:
Sünde (Sin): In diesem Schritt überlegst du, ob der Bibeltext eine spezifische Sünde aufzeigt, vor der du dich hüten solltest. Es geht darum, persönliche Fehler oder falsche Verhaltensweisen zu erkennen, die der Text anspricht. Sprich, Sünde, wird hier als Verfehlung gegenüber den „Lebens fördernden Standards“ definiert.
Verheißung (Promise): Hier suchst du nach Verheißungen in dem Text. Das können Zusagen Gottes sein, die dir Mut, Hoffnung oder Trost geben. Diese Verheißungen sind Erinnerungen an Gottes Charakter und seine treue Fürsorge.
Aktion (Action): Dieser Teil betrachtet, welche Handlungen oder Verhaltensänderungen der Text vorschlägt. Es geht um konkrete Schritte, die du unternehmen kannst, um deinen Glauben in die Tat umzusetzen.
Appell (Command): Hier identifizierst du, ob es in dem Text ein direktes Gebot oder eine Aufforderung gibt, die Gott an seine Leser richtet. Dieser Schritt hilft dir, Gottes Willen für dein Leben besser zu verstehen.
Beispiel (Example): Schließlich suchst du nach Beispielen im Text, die du nachahmen (oder manchmal auch vermeiden) solltest. Das können Handlungen oder Charaktereigenschaften von Personen in der Bibel sein, die als Vorbild dienen.
Diese Methode hilft dabei, die Bibel nicht nur als historisches oder spirituelles Dokument zu lesen, sondern sie auch praktisch und persönlich anzuwenden. Sie dient dazu, das Wort Gottes lebendig und relevant im Alltag zu machen.