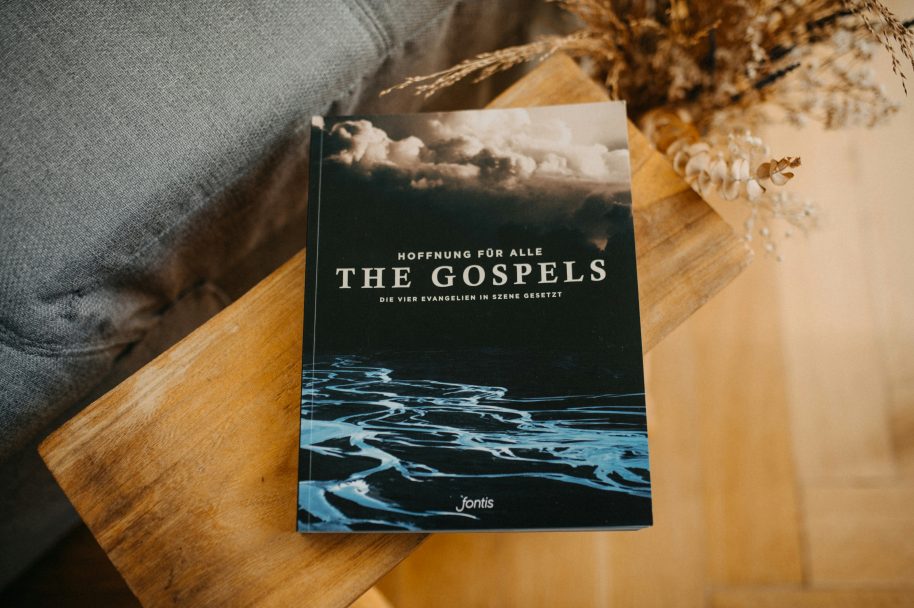Fettgedrucktes für schnell Leser…
Einleitender Impuls:
Stell dir vor, die Jünger hätten gezögert. Stell dir vor, sie hätten gesagt: „Das ist zu groß für uns. Das ist zu gefährlich. Vielleicht behalten wir es besser für uns.“ Stell dir vor, die Nachricht von Jesus wäre irgendwo auf halbem Weg steckengeblieben – in den engen Gassen Jerusalems, in der Angst der Verfolgten, in den Zweifeln derer, die sich unfähig fühlten. Dann wäre sie nie bis zu uns gekommen.
Aber sie haben sich getraut. Sie haben sich bewegen lassen, sie sind losgegangen, haben erzählt, riskiert, geteilt. Manche von ihnen haben dafür alles gegeben – nicht, weil sie es mussten, sondern weil sie es nicht für sich behalten konnten. Weil diese Nachricht zu groß war, um sie einzusperren. Und genau deshalb sind wir hier. Jemand hat dir diese Botschaft weitergegeben. Vielleicht deine Eltern, ein Freund, eine Predigt, ein Buch – aber irgendwann ist sie auf dich getroffen. Und sie hat etwas in dir bewegt.
Das Evangelium ist nicht eine Geschichte, die man einfach hört und ablegt wie eine gute Anekdote. Es ist eine Realität, die sich weiterträgt – von Mensch zu Mensch, von Herz zu Herz. Und vielleicht ist genau das heute die Herausforderung: Nicht einfach nur Empfänger zu bleiben, sondern selbst ein Glied in dieser Kette zu sein. Weil die Welt nicht weniger Hoffnung braucht als damals. Weil Menschen immer noch Fragen haben, Angst, Zweifel – und weil diese Nachricht die stärkste ist, die es gibt. Und sie lebt weiter, wenn wir sie nicht für uns behalten.
Fragen zur Vertiefung oder für Gruppengespräche:
- Wer hat dir von Jesus erzählt – und wie hat das dein Leben verändert?
- Warum fällt es manchmal schwer, den Glaube zu teilen? Welche Ängste oder Unsicherheiten spielen eine Rolle?
- Wenn du dir vorstellst, dass das Evangelium in deiner Generation „stecken bleibt“ – was macht das mit dir?
Parallele Bibeltexte als Slogans:
Römer 10,14 — „Wie sollen sie glauben, wenn niemand es ihnen sagt?“
2. Korinther 5,20 — „Wir sind Botschafter an Christi statt“
Matthäus 28,19-20 — „Geht und macht zu Jüngern alle Völker“
1. Petrus 3,15 — „Seid stets bereit, Rede und Antwort zu stehen“
Wenn du wissen willst, warum dein Glaube nicht zufällig bei dir gelandet ist und was das für deine eigene Geschichte bedeutet, dann lies weiter – es könnte dich überraschen, wie viel in diesem einen Auftrag steckt.
Die Informationen für den Impuls hole ich mir meistens aus BibleHub.com damit auch du es nachschlagen kannst.
Schön, dass wir gemeinsam tiefer in diesen kraftvollen Auftrag eintauchen. Markus 16,15 ist nicht nur ein Vers – es ist eine Mission, eine Herausforderung und ein Abenteuer zugleich. Bevor wir starten, lass uns die Betrachtung mit einem Gebet beginnen:
Lieber Vater, du hast uns einen Auftrag gegeben, der größer ist als wir selbst. In Markus 16,15 rufst du uns hinaus in die Welt, um deine Botschaft zu teilen. Doch oft zögern wir, haben Zweifel oder wissen nicht, wo wir anfangen sollen. Schenk uns Mut, Klarheit und ein Herz, das bereit ist zu gehen – dorthin, wo du uns brauchst. Hilf uns zu verstehen, dass wir nicht allein sind, sondern dass du uns führst und ausrüstest. Lass uns mit offenen Augen und einem mutigen Geist die nächsten Schritte gehen.
In Jesu Namen beten wir,
Amen.
Der Text:
Zunächst werfen wir einen Blick auf den Text in verschiedenen Bibelübersetzungen. Dadurch gewinnen wir ein tieferes Verständnis und können die unterschiedlichen Nuancen des Textes in den jeweiligen Übersetzungen oder Übertragungen besser erfassen. Dazu vergleichen wir die Elberfelder 2006 (ELB 2006), Schlachter 2000 (SLT), Luther 2017 (LU17), Basis Bibel (BB) und die Hoffnung für alle 2015 (Hfa).
Markus 16,15
ELB 2006 Und er sprach zu ihnen: Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung!
SLT Und er sprach zu ihnen: Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung!
LU17 Und er sprach zu ihnen: Gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur.
BB Jesus sagte zu den elf Jüngern: »Geht in die ganze Welt hinaus. Verkündet allen Menschen die Gute Nachricht.
HfA Dann sagte er zu ihnen: »Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die rettende Botschaft.
Der Kontext:
In diesem Abschnitt geht es darum, die grundlegenden Fragen – das „Wer“, „Wo“, „Was“, „Wann“ und „Warum“ – zu klären. Das Ziel ist es, ein besseres Bild von der Welt und den Umständen zu zeichnen, in denen dieser Vers verfasst wurde. So bekommen wir ein tieferes Verständnis für die Botschaft, bevor wir uns den Details widmen.
Kurzgesagt… Markus 16,15 ist Teil von Jesu letztem Auftrag an seine Jünger: „Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die rettende Botschaft.“ Klingt klar und direkt – aber dieser Satz fällt nicht einfach aus dem Himmel. Er steht an einem entscheidenden Wendepunkt: Jesus ist auferstanden, seine Jünger stehen zwischen Furcht und Begeisterung, und das, was jetzt kommt, wird alles verändern.
Previously on… Die Geschichte spielt nach der Kreuzigung. Jesus war tot, begraben, scheinbar besiegt – bis Frauen am Grab eine himmlische Überraschung erleben: Das Grab ist leer, ein Engel verkündet die Auferstehung. Die Jünger? Die glauben es erst mal nicht. Typisch. Jesus muss ihnen persönlich erscheinen, um den letzten Zweifel zu zerstreuen. Nach Tagen der Unsicherheit, des Staunens und neuer Hoffnung steht er nun vor ihnen – und gibt ihnen einen Befehl, der größer ist als alles, was sie bisher kannten.
Aber warum gerade jetzt? In diesem Moment hat sich für die Jünger alles verändert. Sie sind nicht mehr nur Anhänger eines charismatischen Lehrers, sondern Augenzeugen eines Wunders, das die Welt auf den Kopf stellt. Doch die jüdische Welt um sie herum ist immer noch dieselbe: Unter römischer Herrschaft, voller religiöser Spannungen und mit einer tief verwurzelten Vorstellung davon, wer zum Volk Gottes gehört – und wer nicht. Dass diese Botschaft nun „allen Menschen“ gelten soll, sprengt den Rahmen dessen, was sie gewohnt sind.
Der geistige Hintergrund? Die Erwartung des Messias war für viele Juden eine nationale Angelegenheit. Er sollte das Volk Israel befreien, das Reich Gottes errichten – aber dass der Messias sterben und dann von den Toten auferstehen würde, war für die meisten eine völlig absurde Vorstellung. Die Pharisäer und Sadduzäer hatten sich bereits die Köpfe über Theologie heiß geredet, aber diese Entwicklung hatte keiner kommen sehen. Jetzt, wo Jesus auferstanden ist, steht eine neue Frage im Raum: Was bedeutet das für die Welt?
Die Spannung dahinter? Jesus ruft seine Jünger dazu auf, seine Botschaft über Israel hinauszutragen – eine direkte Konfrontation mit tief verwurzelten Denkweisen. Der Glaube, der bis hierhin vor allem für das jüdische Volk gedacht war, soll jetzt global werden. Das bedeutet kulturellen Clash, theologische Auseinandersetzungen und eine Mission, die bei vielen auf Widerstand stoßen wird. Kein Wunder, dass sich die Jünger erst mal sammeln mussten.
Und damit stehen wir vor den entscheidenden Worten, die Jesus wählt. Welche Begriffe benutzt er genau? Was meint er mit „gehen“, „verkünden“ und „alle Welt“? Es wird Zeit, uns die Schlüsselwörter im Detail anzusehen.
Die Schlüsselwörter:
In diesem Abschnitt wollen wir uns genauer mit den Schlüsselwörtern aus dem Text befassen. Diese Worte tragen tiefere Bedeutungen, die oft in der Übersetzung verloren gehen oder nicht auf den ersten Blick ersichtlich sind. Wir werden die wichtigsten Begriffe aus dem ursprünglichen Text herausnehmen und ihre Bedeutung näher betrachten. Dabei schauen wir nicht nur auf die wörtliche Übersetzung, sondern auch darauf, was sie für das Leben und den Glauben bedeuten. Das hilft uns, die Tiefe und Kraft dieses Verses besser zu verstehen und ihn auf eine neue Weise zu erleben.
Markus 16,15 – Ursprünglicher Text (Nestle-Aland 28):
Καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Πορευθέντες εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει.
Übersetzung Markus 16,15 (Elberfelder 2006):
„Und er sprach zu ihnen: Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung!“
Semantisch-pragmatische Kommentierung der Schlüsselwörter
- εἶπεν (eipen) – „Er sprach“: Hier geht es nicht um eine beiläufige Bemerkung. Das Wort eipen ist ein Aorist, also eine abgeschlossene Handlung – Jesus sagt es mit Autorität, ein klarer, finaler Befehl. Es ist kein Vorschlag, keine Einladung zum Diskurs, sondern eine direkte Instruktion. Im griechischen Denken ist „sagen“ oft mehr als nur Worte – es bedeutet festlegen, bestimmen, sogar erschaffen. Wer spricht, setzt etwas in Bewegung.
- Πορευθέντες (poreuthentes) – „Geht“: Wörtlich bedeutet das „sich auf den Weg machen“, aber der grammatische Trick hier ist spannend: Es ist ein Partizip Aorist, was bedeutet, dass es in der Struktur so etwas wie „Während ihr geht…“ ausdrückt. Jesus sagt also nicht nur „Los geht’s!“, sondern „Während ihr euch sowieso bewegt, verkündet…“ Es ist also keine einmalige Mission, sondern eine kontinuierliche Bewegung – Glaube ist kein Standpunkt, sondern ein Weg.
- κόσμον (kosmon) – „Welt“: Das Wort kosmos hat eine tiefe Bedeutung. Es kann schlicht „Welt“ heißen, aber es meint nicht nur den geografischen Raum, sondern auch die Menschheit, die Gesellschaft, die Ordnung der Dinge. Im antiken Denken war die Welt ein geordnetes Ganzes (daher unser Wort „Kosmetik“ – etwas in Ordnung bringen). Jesus bezieht seine Botschaft also nicht nur auf die Erde als Planeten, sondern auf das ganze System, das die Menschheit umgibt.
- ἅπαντα (hapanta) – „Ganze“: Dieser Begriff verstärkt die Totalität der Aussage. Jesus grenzt nichts aus. Kein Volk, keine Gruppe, kein Einzelner bleibt außen vor. Es ist ein radikales Konzept, besonders in einer Zeit, in der Religion oft an Nationen, Ethnien und geschlossene Gemeinschaften gebunden war.
- κηρύξατε (kēryxate) – „Verkündet“: Hier steckt das Wort kēryx drin – ein Herold, der Nachrichten verkündet. Es geht nicht um eine lockere Unterhaltung oder sanfte Überredung, sondern um eine offizielle, öffentliche Bekanntmachung. Das Verb steht im Imperativ, also als ein klarer Befehl. Man kann es sich vorstellen wie einen königlichen Herold, der auf den Marktplatz tritt und mit fester Stimme eine offizielle Erklärung verkündet. Jesus sieht seine Jünger also als Boten einer Nachricht, die nicht verhandelbar ist – sie muss raus.
- εὐαγγέλιον (euangelion) – „Evangelium“: Dieses Wort bedeutet wörtlich „Gute Nachricht“, aber im damaligen Kontext war es ein politischer Begriff. Ein „Evangelium“ war eine Verkündung von Siegen, oft vom Kaiser selbst. Dass Jesus genau diesen Begriff benutzt, ist ein direkter Kontrast zur römischen Herrschaft: Hier kommt eine andere Botschaft, ein anderes Reich, eine andere Rettung – eine, die nicht durch Militär, sondern durch Wahrheit und Liebe erobert.
- πάσῃ (pasē) – „Jeder/jede“: Auch hier wieder die absolute Inklusivität. Keine Einschränkungen. Keine Ausnahmen. Es ist ein allumfassender Auftrag – keine Elite, keine auserwählten Empfänger, sondern eine Botschaft für jeden.
- κτίσει (ktisei) – „Schöpfung“: Normalerweise erwarten wir hier das Wort für „Menschen“, aber ktisis bedeutet „das Geschaffene“ – nicht nur Menschen, sondern alles, was existiert. Das ist theologisch interessant, weil es bedeutet, dass das Evangelium eine Botschaft ist, die über die Menschheit hinausgeht. Es betrifft die ganze Welt, die Natur, das gesamte Universum – eine Botschaft der Wiederherstellung für die gesamte Schöpfung.
Was bedeutet das alles? Jesus schickt seine Jünger nicht nur auf eine Mission – er steckt sie in einen globalen Auftrag, der die Menschheit und die gesamte Schöpfung umfasst. Seine Botschaft ist kein Lokalereignis, sondern eine universale Realität. Es geht nicht nur um Lehren, sondern um eine proklamierte Wahrheit, die jeden erreichen soll.
Und genau hier setzen wir an: Was bedeutet das theologisch? Welche Konsequenzen hat dieser Auftrag – nicht nur für die Jünger damals, sondern auch für uns heute? Es wird Zeit für eine tiefere Reflexion über den theologischen Gehalt dieses Verses.
Ein Kommentar zum Text:
Markus 16,15 – Der Auftrag, der die Welt auf den Kopf stellt
Stell dir vor, du stehst da. Jesus, auferstanden, lebendig vor dir. Deine Gedanken rasen: „Ist das wirklich echt? Was passiert hier?“ Und dann kommen diese Worte – keine langen Erklärungen, keine Debatten, kein sanftes Heranführen – ein klarer, kompromissloser Befehl: „Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung.“
In diesem Moment verändert sich alles. Bis hierhin war das Reich Gottes etwas, das in Israel, unter dem jüdischen Volk, seinen Platz hatte. Jetzt explodiert dieser Rahmen. Was bisher lokal war, wird global. Was exklusiv schien, wird universal. Jesus öffnet eine Tür, die nie wieder geschlossen werden kann.
Diese wenigen Worte bergen eine theologische Sprengkraft, die damals wie heute herausfordert. Denn hier treffen zwei Welten frontal aufeinander: die enge, religiöse Exklusivität und der radikale, grenzenlose Auftrag. Die meisten Juden seiner Zeit erwarteten den Messias als Erlöser Israels – nicht als einen, der sich für alle Völker und sogar für „die ganze Schöpfung“ (πᾶσα ἡ κτίσις, pasa hē ktisis) interessierte.
Doch genau das tut Jesus. „Kosmos“ (κόσμος, kosmos) bedeutet hier nicht nur „die Erde“, sondern die ganze Weltordnung, alle Kulturen, alle Menschen, alle Systeme. Das Evangelium ist nicht nur für eine bestimmte Nation oder eine elitäre Gruppe, sondern für jede einzelne Person – unabhängig von Herkunft, Status oder Geschichte.
Das Problem? Die Jünger haben noch nicht realisiert, was das wirklich bedeutet. Dass Jesus den römischen Hauptmann geheilt hat (Matthäus 8,5-13), dass er mit Samaritern sprach (Johannes 4,1-42), dass er immer wieder die Außenseiter bevorzugte – das waren alles Hinweise, doch jetzt macht er es unmissverständlich klar: Die Grenze ist gefallen.
Das erste Schlüsselwort hier ist „Geht“ (Πορευθέντες, Poreuthentes), ein Partizip Aorist, das grammatikalisch spannend ist. Es steht nicht im Imperativ (also als direkter Befehl), sondern signalisiert: Während ihr geht, sollt ihr verkünden. Das bedeutet: Mission ist kein Projekt, das man irgendwann startet – es ist ein Lebensstil.
Das setzt eine andere Perspektive voraus: Glaube ist nicht statisch. Er sitzt nicht in einem Gebäude und wartet, dass Menschen kommen. Er bewegt sich, er reist, er tritt ein in die Welt – in die Orte, wo Menschen sind, wo das Leben pulsiert.
Hier spüren wir schon die Herausforderung: Das Evangelium ist nicht für Zuschauer, sondern für Menschen, die bereit sind, aktiv zu werden.
Das zweite explosive Wort ist „verkündet“ (κηρύξατε, kēryxate). Das ist nicht sanftes Erzählen oder diskretes Teilen – es ist eine öffentliche, offizielle Proklamation, wie sie ein Herold im Auftrag eines Königs macht. Im Römischen Reich wurde dieses Wort verwendet, wenn ein Bote einen neuen Erlass oder eine große politische Nachricht verkündete. Das Evangelium wird also als etwas präsentiert, das nicht zur Diskussion steht – es ist eine Wahrheit, die verkündet werden muss.
Doch hier kommt die Spannung: Wie verkündet man eine Botschaft, die nicht immer willkommen ist? Die frühen Christen standen unter massivem Druck. Der römische Kaiser beanspruchte absolute Loyalität – und jetzt kommen Nachfolger eines gekreuzigten Mannes und behaupten, dass nicht Cäsar, sondern Jesus König ist?
Die erste Gemeinde erlebte genau das: Petrus und Johannes wurden verhaftet (Apostelgeschichte 4,3), Paulus verfolgt, Stephanus gesteinigt. Und doch hörten sie nicht auf – weil sie wussten: Diese Botschaft ist keine Option, sondern eine Notwendigkeit.
Das Wort „Evangelium“ (εὐαγγέλιον, euangelion) wurde damals nicht in der Religion, sondern in der Politik benutzt. Es war die Verkündung eines Sieges, eines neuen Herrschers oder eines entscheidenden Wendepunkts in der Geschichte.
Wenn also Jesus seinen Jüngern befiehlt, das Evangelium zu verkünden, dann sagt er: „Verkündet eine neue Realität – dass durch mich eine völlig neue Ordnung beginnt.“ Das ist revolutionär. Denn das Evangelium ist nicht nur eine persönliche Errettung, sondern die Ansage: Die Welt ist nicht mehr dieselbe. Gott selbst hat eingegriffen.
Doch Achtung: Das Evangelium ist kein bloßer Trost für schwere Zeiten. Es ist eine Einladung in ein neues Königreich – und eine Herausforderung für alles, was sich gegen dieses Reich stellt. Es bedeutet Umkehr, Transformation, eine neue Perspektive auf das Leben.
Jetzt kommt die vielleicht ungewöhnlichste Formulierung: „Der ganzen Schöpfung“ (πάσῃ τῇ κτίσει, pasē tē ktisei).
Warum spricht Jesus nicht einfach von „allen Menschen“? Warum sollte die gesamte Schöpfung das Evangelium hören?
Paulus greift diesen Gedanken in Römer 8,19-22 auf, wo er sagt, dass die ganze Schöpfung unter der Sünde leidet und auf Erlösung wartet. Jesus kam nicht nur, um individuelle Seelen zu retten, sondern um alles wiederherzustellen – die gesamte Schöpfung, die unter der Zerbrochenheit leidet.
Das bedeutet: Das Evangelium betrifft nicht nur unser spirituelles Leben, sondern alles – Gesellschaft, Kultur, Natur, Beziehungen. Es geht um Heilung auf allen Ebenen. Ein Christ, der das Evangelium ernst nimmt, sollte daher auch soziale Gerechtigkeit, Umweltverantwortung und Versöhnung im Blick haben.
Markus 16,15 ist kein einfacher Vers. Er ruft uns aus der Komfortzone. Er fordert uns heraus, neu zu denken. Glaube ist kein Privileg für eine kleine Gruppe, sondern eine globale Botschaft.
Doch wie setzen wir das praktisch um? Wie kann dieser Auftrag heute in unserem Alltag Gestalt annehmen?
Hier kommt die SPACE-Methode ins Spiel. Sie hilft uns, diesen Vers nicht nur zu verstehen, sondern ganz konkret anzuwenden – in unserer Denkweise, unserem Handeln und unserem Glauben. Bereit, es praktisch werden zu lassen? Dann lass uns weitermachen.
Die SPACE-Anwendung*
Die SPACE-Anwendung ist eine Methode, um biblische Texte praktisch auf das tägliche Leben anzuwenden. Sie besteht aus fünf Schritten, die jeweils durch die Anfangsbuchstaben von „SPACE“ repräsentiert werden:
S – Sünde (Sin)
Man könnte ja meinen, dass dieser Vers gar keine Sünde anspricht – schließlich geht es um einen Auftrag, nicht um eine Warnung. Aber genau hier liegt der Knackpunkt. Die Sünde, die dieser Text indirekt entlarvt, ist Passivität. Stagnation. Ein Glaube, der sich in der Komfortzone einrichtet und sich damit begnügt, „gut mit Gott zu sein“, während die Welt draußen weiterdreht.
Jesus sagt nicht: „Bleibt, wo ihr seid, und wenn jemand fragt, dann erzählt ihr halt ein bisschen was von mir.“ Nein. „Geht.“ Aktiv. Raus aus dem sicheren Kreis, hinein in die Welt. Die Sünde wäre also, das Evangelium nur für sich zu behalten – es als ein persönliches Trostpflaster zu sehen, aber nicht als eine lebendige Realität, die geteilt werden muss. Die Tragik? Wenn wir es nicht teilen, dann nicht, weil wir „noch nicht bereit“ sind, sondern weil unser Herz vielleicht gar nicht so sehr davon überfließt, wie wir dachten.
Die Konsequenz dieser Passivität? Das Evangelium bleibt ein Konzept, eine Theologie, ein guter Gedanke – aber nicht eine Kraft, die die Welt verändert. Und genau das wäre der eigentliche Verlust.
P – Verheißung (Promise)
Der Text selbst enthält keine direkte Verheißung – aber zwischen den Zeilen steckt eine der größten Zusagen der Bibel: Wenn Jesus uns sendet, dann bedeutet das, dass er auch mit uns geht.
Wir müssen nicht selbst die perfekte Strategie haben oder immer die richtigen Worte finden. Der Auftrag steht auf der Autorität Jesu, nicht auf unserer Fähigkeit, überzeugend zu sein. Matthäus 28,20 macht das explizit: „Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt.“
Das bedeutet: Wir gehen nicht allein. Egal, wo, egal wie herausfordernd – wir sind nicht die Helden der Geschichte, sondern die Boten. Und die Botschaft selbst hat die Kraft, Menschen zu verändern.
A – Aktion (Action)
Hier wird es praktisch – was bedeutet dieser Text für unser Leben? Klar, wir könnten jetzt sagen: „Na gut, dann mal los, raus auf die Straße, predigen!“ Aber ganz ehrlich – wenn Verkündigung nur bedeutet, dass man lauter redet, dann läuft irgendwas schief.
Es geht nicht nur um Worte, sondern um Haltung. Was wäre, wenn unser Leben die Verkündigung ist? Wenn unser Umgang mit Menschen, unsere Werte, unser Charakter so sehr von der Botschaft Jesu geprägt sind, dass sie von selbst sichtbar wird?
Dafür wäre es gut, erst einmal einen internen Perspektivwechsel zu vollziehen. Jesus sagt nicht: „Versuch’s mal, wenn du dich bereit fühlst.“ Er sagt: „Geht.“ Das bedeutet, dass Glaube nicht ein Ort ist, an dem man irgendwann „angekommen“ ist, sondern eine Bewegung. Und das bedeutet auch: Perfektion ist keine Voraussetzung für Verkündigung. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt.
Ein nächster Schritt könnte sein: Die eigene „Bewegungslosigkeit“ reflektieren. Wo habe ich mir im Glauben eine bequeme Insel gebaut? Wo lasse ich mich nur von Gleichgesinnten umgeben, statt wirklich in die Welt hinauszugehen? Der Auftrag von Markus 16,15 bedeutet nicht, dass jeder sofort in die Mission nach Afrika aufbricht – aber vielleicht bedeutet er, die eigene Nachbarschaft mit anderen Augen zu sehen.
C – Appell (Command)
Hör nicht auf, die Wahrheit zu verkünden – durch dein Leben, deine Worte, dein Tun.
Es geht nicht darum, dass jeder ein Prediger wird, sondern darum, dass jeder dort, wo er ist, als lebendiger Zeuge Christi sichtbar ist. Verkündigung bedeutet nicht nur, auf Bühnen oder Kanzeln zu stehen – sie bedeutet, in der Art, wie wir arbeiten, lieben, vergeben, diskutieren und sogar scheitern, einen Unterschied zu machen.
Es wäre gut, wenn wir aufhören würden, Evangelisation als „eine besondere Aufgabe für einige wenige“ zu sehen. Sie ist ein natürlicher Teil eines lebendigen Glaubens.
E – Beispiel (Example)
Ein perfektes Beispiel für jemanden, der diese Botschaft verstanden hat, ist Paulus. In Apostelgeschichte 17,22-34 steht er in Athen vor den Philosophen auf dem Areopag. Und was tut er? Er hält keine aggressive Predigt, sondern findet Anknüpfungspunkte, baut Brücken, spricht die Sprache der Menschen, die vor ihm stehen. Er verkündet das Evangelium – aber auf eine Weise, die seine Zuhörer herausfordert, ohne sie direkt abzulehnen.
Ein weiteres Beispiel ist die Geschichte der Samariterin am Jakobsbrunnen (Johannes 4,1-42). Jesus offenbart ihr die Wahrheit über ihr Leben – nicht mit Verurteilung, sondern mit liebevoller Klarheit. Das Ergebnis? Sie selbst wird zur Verkündigerin, obwohl sie gerade erst von Jesus gehört hat! Das zeigt: Jeder kann die Botschaft weitergeben – man muss nicht erst „spirituell ausgereift“ sein.
Der Punkt ist: Menschen, die Jesus begegnet sind, haben ihn weitergegeben – nicht, weil sie mussten, sondern weil sie nicht anders konnten.
Und das führt uns zum nächsten Schritt: der persönlichen Identifikation mit dem Text. Denn am Ende stellt sich nicht die Frage: „Was hat der Text zu sagen?“ Sondern: „Was sagt er mir?“
Persönliche Identifikation mit dem Text:
In diesem Schritt stelle ich mir sogenannte „W“ Fragen: „Was möchte der Text mir sagen?“ in der suche nach der Hauptbotschaft. Dann überlege ich, „Was sagt der Text nicht?“ um Missverständnisse zu vermeiden. Ich reflektiere, „Warum ist dieser Text für mich wichtig?“ um seine Relevanz für mein Leben zu erkennen. Anschließend frage ich mich, „Wie kann ich den Text in meinem Alltag umsetzen/anwenden?“ um praktische Anwendungsmöglichkeiten zu finden. Weiterhin denke ich darüber nach, „Wie wirkt sich der Text auf meinen Glauben aus?“ um zu sehen, wie er meinen Glauben stärkt oder herausfordert. Schließlich frage ich, „Welche Schlussfolgerungen kann ich für mich aus dem Gesagten ziehen?“ um konkrete Handlungen und Einstellungen abzuleiten.
Manchmal frage ich mich, ob ich den Auftrag von Markus 16,15 wirklich ernst nehme – oder ob ich mich unbewusst mit einer soften Version davon begnüge. „Geht hinaus in die Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung“ – klingt groß, klingt episch, klingt… unfassbar herausfordernd. Und genau hier fängt es an, unangenehm zu werden.
Denn wenn ich ganz ehrlich bin: Ich mag Komfort. Ich mag es, wenn mein Glaube mich inspiriert, mir Kraft gibt und mich innerlich wachsen lässt. Aber „hinausgehen“? „Verkündigen“? Das klingt nach Aktivismus, nach einer Mission, die Energie kostet, nach Gesprächen, die vielleicht auf Widerstand stoßen. Es bedeutet, meine Überzeugung nicht nur für mich zu behalten, sondern sie sichtbar zu machen – und das ist viel unbequemer, als es sich in einem sicheren Raum mit Gleichgesinnten gut gehen zu lassen.
Und genau hier liegt der eigentliche Konflikt dieses Textes. Er fordert mich heraus, meinen Glauben nicht als etwas Privates zu betrachten, sondern als eine Bewegung, eine lebendige Kraft, die geteilt werden muss. Und das bringt eine unangenehme Frage mit sich: Glaube ich wirklich, dass das Evangelium eine so gute Nachricht ist, dass ich nicht anders kann, als es weiterzugeben? Oder ist es für mich eher eine nette Idee, eine persönliche Wahrheit, die mir Halt gibt, aber keine universelle Realität, die die Welt braucht?
Dabei sagt dieser Text nicht, dass ich ab morgen mit einem Megafon auf der Straße stehen soll. Er sagt nicht, dass ich jedem Menschen eine Predigt halten muss. Aber er sagt, dass das Evangelium nicht nur für mich existiert. Dass es sich nicht in meinem Kopf oder in einer sicheren Gemeinschaft einschließen lässt. Dass es hinaus will – nicht, weil es eine Pflicht ist, sondern weil es in seiner Natur liegt, Leben zu verändern.
Und das bedeutet für mich konkret: Ich kann diesen Auftrag nicht einfach „outsourcen“ an Menschen, die „dafür begabt sind“. Ich kann nicht sagen: „Mission ist nicht mein Ding.“ Denn wenn ich glaube, dass das Evangelium echte Hoffnung bringt, dann wäre es seltsam, es nicht weiterzugeben. Das bedeutet nicht, dass jeder Christ gleich klingen oder handeln muss – aber es bedeutet, dass mein Glaube eine Bewegung ist, keine Insel.
Und hier kommt die nächste Herausforderung: Was bedeutet „verkünden“ eigentlich in meiner Lebensrealität? Die ersten Christen lebten in einer Zeit, in der „Verkündigung“ oft bedeutete, dass du verfolgt, ausgelacht oder sogar getötet wurdest. Heute ist es anders – aber nicht unbedingt einfacher. Heute leben wir in einer Welt, die Wahrheit als etwas Subjektives sieht. „Jeder hat seine eigene Wahrheit, solange sie niemandem wehtut.“ Wenn ich also sage: „Das Evangelium ist nicht nur eine von vielen netten Ideen, sondern DIE beste Nachricht, die es gibt“, dann ist das eine kühne, fast schon anstößige Aussage.
Und doch glaube ich, dass genau hier eine große Chance liegt. Vielleicht bedeutet Verkündigung heute nicht, lauter zu schreien, sondern echter zu sein. Vielleicht bedeutet es, den Glauben nicht als eine Theologie abzuhaken, sondern als eine Realität zu leben. Vielleicht fängt Evangelisation nicht mit Worten, sondern mit der Art an, wie ich Menschen behandle – mit meiner Großzügigkeit, mit meiner Fähigkeit zu vergeben, mit meiner Bereitschaft, wirklich zuzuhören, mit meinem Mut, in schwierigen Gesprächen authentisch zu bleiben.
Und genau hier spüre ich, wie der Text mich trifft. Wenn ich glaube, dass Jesus lebt, dass er König ist, dass er die Welt erneuert – dann kann ich nicht neutral bleiben. Dann bedeutet „Geht hinaus“ für mich vielleicht, mutiger in meinen Gesprächen zu sein. Oder weniger Angst davor zu haben, als „zu fromm“ zu gelten. Oder den Glauben nicht als Privatsache zu behandeln, sondern als eine Einladung, die andere inspirieren könnte.
Das ist nicht immer easy. Manchmal ist es bequemer, den Mund zu halten. Aber was, wenn wir das Evangelium nicht als Bürde sehen, sondern als Geschenk? Was, wenn es nicht darum geht, „Leute zu überzeugen“, sondern darum, sie mit der besten Nachricht der Welt bekannt zu machen?
Also, was tun? Ich denke, es wäre gut, mal ehrlich zu reflektieren: Wo bin ich in meinem Glauben bewegungslos geworden? Wo rede ich mir ein, dass Evangelisation nichts mit mir zu tun hat? Und wo könnte ich mutiger sein – nicht aus Pflicht, sondern weil diese Botschaft es wert ist, geteilt zu werden?
Ich weiß nicht, wie das für dich aussieht – aber ich lade dich ein, diesen Text nicht als Befehl zu sehen, sondern als einen Ruf in etwas Größeres. Etwas, das dein Leben nicht kleiner, sondern größer macht. Denn wenn das Evangelium wirklich eine gute Nachricht ist, dann wäre es schade, sie für sich zu behalten.
*Die SPACE-Analyse im Detail:
Sünde (Sin): In diesem Schritt überlegst du, ob der Bibeltext eine spezifische Sünde aufzeigt, vor der du dich hüten solltest. Es geht darum, persönliche Fehler oder falsche Verhaltensweisen zu erkennen, die der Text anspricht. Sprich, Sünde, wird hier als Verfehlung gegenüber den „Lebens fördernden Standards“ definiert.
Verheißung (Promise): Hier suchst du nach Verheißungen in dem Text. Das können Zusagen Gottes sein, die dir Mut, Hoffnung oder Trost geben. Diese Verheißungen sind Erinnerungen an Gottes Charakter und seine treue Fürsorge.
Aktion (Action): Dieser Teil betrachtet, welche Handlungen oder Verhaltensänderungen der Text vorschlägt. Es geht um konkrete Schritte, die du unternehmen kannst, um deinen Glauben in die Tat umzusetzen.
Appell (Command): Hier identifizierst du, ob es in dem Text ein direktes Gebot oder eine Aufforderung gibt, die Gott an seine Leser richtet. Dieser Schritt hilft dir, Gottes Willen für dein Leben besser zu verstehen.
Beispiel (Example): Schließlich suchst du nach Beispielen im Text, die du nachahmen (oder manchmal auch vermeiden) solltest. Das können Handlungen oder Charaktereigenschaften von Personen in der Bibel sein, die als Vorbild dienen.
Diese Methode hilft dabei, die Bibel nicht nur als historisches oder spirituelles Dokument zu lesen, sondern sie auch praktisch und persönlich anzuwenden. Sie dient dazu, das Wort Gottes lebendig und relevant im Alltag zu machen.