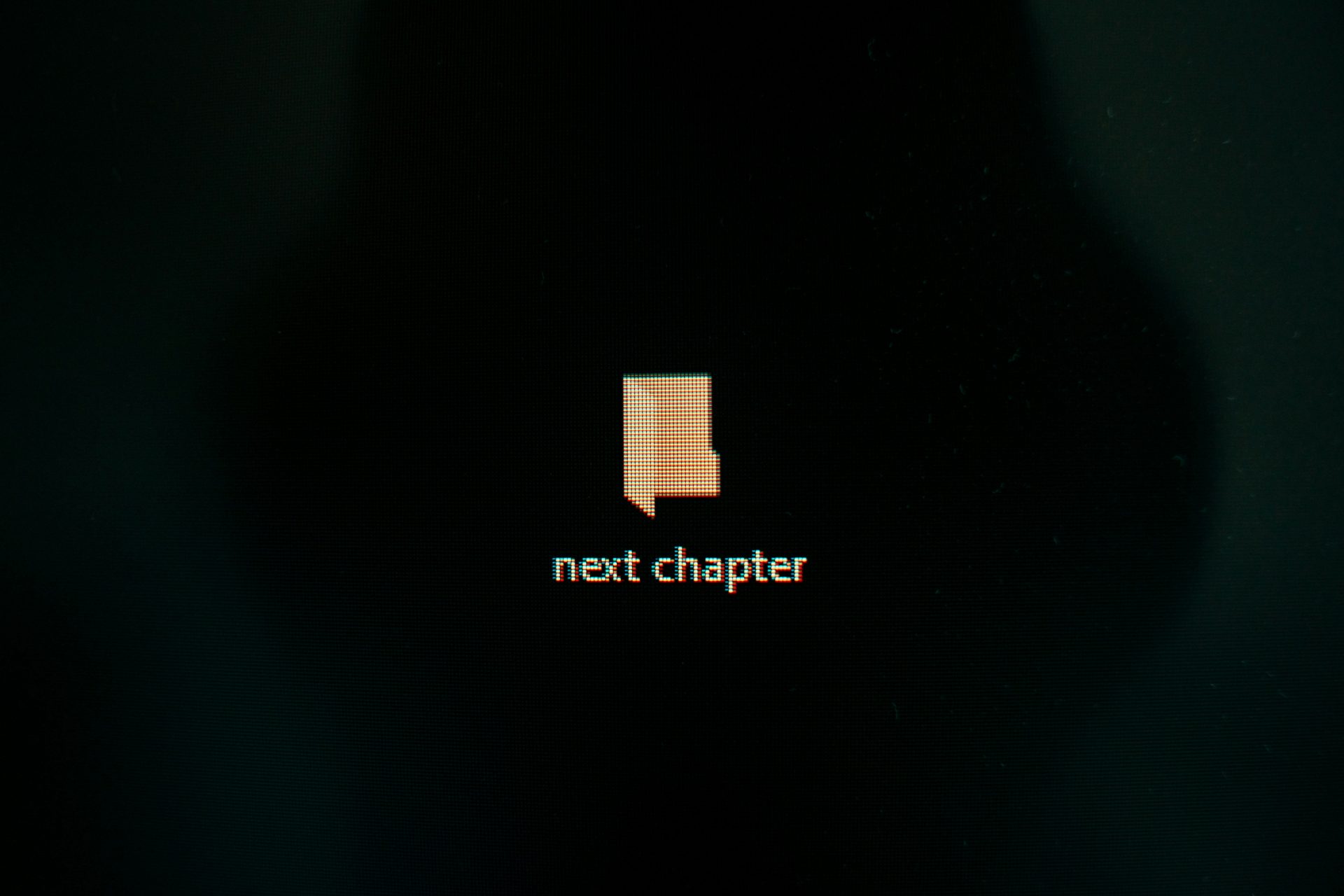Fettgedrucktes für schnell Leser…
Einleitender Impuls:
Es war nur ein schlichter Umschlag. Ein paar Ecken geknickt, leicht vergilbt. Meine Mutter hatte ihn über Jahrzehnte aufgehoben. Drin: meine Schulzeugnisse. Ich hatte sie längst vergessen – bis jemand mich vor ein paar Tagen danach fragte. „Hast du eigentlich mal auf deine alten Noten geschaut?“ Ich wollte nicht. Ehrlich gesagt: Ich hatte Angst davor. Aber dann lag dieser Umschlag auf dem Tisch. Und ich schlug ihn auf. Und was ich las, war ernüchternd. Die Kommentare der Lehrer: „Dante ist intelligent, aber…“ – immer dieses aber. Er träumt. Er ist abgelenkt. Er passt sich nicht ans System an. Heute würde man sagen: Vielleicht ADHS. Neurodivers. Vielleicht hochsensibel. Vielleicht einfach ein Junge mit einer anderen Taktung. Damals war ich einfach: ein Problem. Und ich glaube, tief drin habe ich das auch geglaubt. Ich war dieser Junge, der sich schämte, wenn andere besser waren. Der dachte, er sei irgendwie defekt. Und dann lese ich diesen einen Satz: „Wer Gott liebt, dem dient alles…“ Und ich frage mich: Auch das?
Ich will dir nichts vormachen. Wenn du gerade in einer Situation steckst, wo du keinen Rückblick hast – wo alles gerade nur verwirrend, hart und offen ist – dann klingt dieser Satz aus Römer 8 vielleicht wie Hohn. Vielleicht hast du Dramen erlebt, die sich nicht einordnen lassen. Vielleicht denkst du beim Lesen: Dante, was weißt du schon? Und weißt du was? Ich versteh dich. Ich bin nicht hier, um dir einen Seelenzucker zu geben. Ich will nur sagen: Ich habe es nicht geplant, diesen Umschlag zu öffnen. Und ich hätte nie gedacht, dass ich Gott heute für diese kaputten Noten und schmerzhaften Momente danken würde. Aber ich tue es. Nicht weil ich masochistisch bin. Sondern weil ich in ihnen etwas sehe, das ich damals nicht sehen konnte: Gott war da. Nicht als Macher dieser Momente – aber als einer, der mitten durch sie hindurchträgt.
Das kleine, unscheinbare Wort „wirken“ in diesem Bibelvers hat es in sich. Im griechischen Urtext steht hier: „synergei“ – (Ursprung von Synergie). Es bedeutet nicht, dass alles von sich aus gut ist. Es heißt: Es wirkt zusammen. Nicht automatisch. Nicht schmerzfrei. Aber mit einem Ziel. Gott verwebt sogar das, was uns überfordert. Seine Güte ist der rote Faden, nicht das, was passiert.
Heute nutze ich genau diese Erinnerungen. Nicht um Schuldige zu suchen. Sondern um anderen Mut zu machen. Nicht weil ich über allem stehe, sondern weil ich weiß, wie sich Versagen anfühlt und was draus werden kann. Ich habe oft das Handtuch geworfen. Aber nie zu weit. Denn ich glaube an einen Gott, der uns motiviert, es wieder und wieder aufzuheben. Und ich frage dich: Was würdest du heute Gott zutrauen – obwohl du es damals nie geglaubt hättest? Vielleicht ist genau das dein Punkt zum Weitergehen. Kein Beweis. Kein sofortiges Happy End. Aber ein leiser Satz, der bleibt: Du bist nicht allein in deiner Geschichte. Du bist nicht zu spät. Und du bist nicht zu wenig.
Fragen zur Vertiefung oder für Gruppengespräche:
- Welche alten Sätze über dich selbst begleiten dich noch heute – auch wenn sie längst überholt sind? Diese Frage lädt dich ein, ehrlich auf die Prägungen deines Selbstbildes zu schauen. Nicht um Schuldige zu suchen – sondern um Raum zu machen für das, was Gott heute über dich sagen will.
- Was hilft dir in Momenten des Zweifelns, dich wieder mit Gottes Blick auf dein Leben zu verbinden? Ziel ist es, praktische Wege zu entdecken, wie du im Alltag geistlich anknüpfen kannst – ohne dich zu überfordern oder etwas zu „müssen“.
- Was, wenn Gott auch durch das spricht, was du eigentlich vergessen wolltest? Die Frage greift das zentrale Thema der Erinnerung und göttlichen Führung auf – sie öffnet einen inneren Raum für Aha-Momente, ohne dich unter Druck zu setzen.
Parallele Bibeltexte als Slogans mit Anwendung:
Psalm 139,5–6 – „Du umschließt mich von allen Seiten.“ → Auch wenn du den Überblick verlierst: Gottes Hand hat dich nie aus dem Blick verloren.
1. Korinther 1,27–29 – „Gott erwählt das Schwache.“ → Vielleicht sieht Gott gerade dort Potenzial, wo du dich als gescheitert empfindest.
Jesaja 43,1 – „Ich habe dich bei deinem Namen gerufen.“ → Du bist keine Nummer in Gottes Plan – du bist eine Geschichte, die ihm gehört.
Philipper 1,6 – „Er wird vollenden, was er angefangen hat.“ → Auch wenn du zwischendurch zweifelst: Gottes Zusagen tragen bis zum Ziel.
Manchmal braucht es nur ein paar Minuten ehrliches Nachdenken, um Gottes Wirken im eigenen Leben neu zu entdecken. Vielleicht ist heute der Moment, an dem du dir Zeit nimmst, die ganze Ausarbeitung zu lesen.
Ausarbeitung zum Impuls
Lass uns kurz zur Ruhe kommen. Vielleicht magst du für einen Moment durchatmen, den Blick von allem anderen abwenden – und dich innerlich öffnen für das, was jetzt kommt.
Liebevoller Vater, du weißt, wie viel gerade in mir und um mich herum los ist. Und trotzdem – oder gerade deshalb – bin ich jetzt hier. Ich will hören, was du mir zeigen möchtest. Wenn du sagst, dass „alle Dinge zum Guten mitwirken“, dann spüre ich, wie sehr ich mir das wünsche – zu glauben, dass du wirklich alles in der Hand hast. Auch das, was ich nicht verstehe. Auch das, was sich nicht gut anfühlt. Ich danke dir für deine Geduld mit mir, für deinen Blick, der weiter reicht als meiner. Hilf mir, mich in deine Perspektive hineinnehmen zu lassen – ohne Zwang, aber mit Vertrauen. Sprich zu meinem Herzen. Im Namen Jesu,
Amen.
Dann lass uns gemeinsam in den Text eintauchen. Wir schauen genau hin – und lassen uns überraschen, was uns erwartet.
Persönliche Identifikation mit dem Text und der Ausarbeitung:
In diesem Ersten Abschnitt geht es nicht darum, den Text zu erklären – sondern ihm zuzuhören. Es ist eigentlich der Letze schritt der Ausarbeitung gewesen, der den Ich nach allen anderen Schritten gegangen bin, die du danach lesen kannst… Ich versuche den Text zu sehen, zu hören zu fühlen und stelle mir die leisen, ehrlichen „W“-Fragen: Was spricht mich an? Was bleibt unausgesprochen? Warum bewegt mich das gerade jetzt? Ich frage mich, wie dieser Vers meinen Alltag berühren kann – nicht theoretisch, sondern greifbar. Und ich spüre nach, was das mit meinem Glauben macht – ob es trägt, fordert, tröstet oder alles zugleich. Am Ende suche ich nicht die perfekte Antwort, sondern eine aufrichtige Reaktion: Was nehme ich mit – ganz persönlich, im Herzen, im Leben, im Blick auf Gott.
Also, bereit?
Ich spreche hier über die Perikope Römer 8,18–30 – über den Trost und die Spannung, die zwischen Leiden, Hoffnung und Berufung stehen. Und ich spreche als jemand, der selbst darin steht.
Was ich sehe, wenn ich diesen Abschnitt lese, ist eine Szene, die aufgeladen ist mit Bewegung – aber nicht mit äußerer Dramatik, sondern innerer Bewegung. Ich sehe nicht Action, sondern Warten. Sehnen. Ein ganzes Universum, das mit angehaltenem Atem auf etwas wartet. Die Schöpfung, der Mensch, ja selbst der Geist Gottes – alle sind irgendwie in dieser Haltung des Wartens. Es ist kein passives Warten. Es ist ein Warten, das etwas sucht, das sich streckt. Wie ein Körper, der vor Schmerz gekrümmt ist – aber sich trotzdem nach etwas ausrichtet, das noch nicht sichtbar ist. Diese Perikope ist nicht laut. Aber sie schreit. Sie schreit nach Erlösung. Nach Sinn. Nach der Offenbarung dessen, was längst verheißen wurde, aber noch nicht vollständig da ist. Und da mittendrin: wir. Menschen mit Brüchen, mit Zweifel, mit unaussprechlichen Seufzern.
Und wenn ich die Augen schließe und mich nur auf das konzentriere, was ich höre, dann ist es nicht einmal der Text selbst, sondern das Dazwischen, das Laut wird. Ich höre Paulus, wie er versucht, Worte zu finden für etwas, das schwer greifbar ist – und dann sagt er einfach: „Wir wissen es nicht.“ Und genau da hinein kommt der Geist – nicht als Erklärer, sondern als Mitbeter. Nicht mit Formulierungen, sondern mit Seufzern. Und das ist für mich fast der heiligste Moment des Textes: Da, wo keine Sprache mehr hinkommt, betet der Geist. Für uns. Durch uns. In uns.
Was ich dabei fühle? Ganz ehrlich: Erleichterung. Weil ich mich selbst in diesem „nicht wissen, was wir beten sollen“ so sehr wiederfinde. Ich bin kein Held des Glaubens. Ich bin oft ein Fragender, ein Zweifelnder, einer, der mit seinem Selbstwert ringt. Der sich manchmal fragt, ob er gemeint ist – wirklich gemeint. Und genau in dieser Unsicherheit spricht Paulus: „Alle Dinge wirken zusammen zum Guten.“ Nicht: Alle Dinge sind gut. Sondern: Sie wirken zusammen. Und das ist eine Zumutung und ein Trost zugleich. Denn ich sehe nicht, wie sich manches zusammenfügt. Ich höre es auch nicht immer. Aber ich bin eingeladen zu glauben, dass es trotzdem geschieht.
Was mir der Text sagen will, ist nicht nur: „Gott hat einen Plan.“ Sondern: „Du bist Teil davon – auch dann, wenn du selbst dich als bruchstückhaft erlebst.“ Er sagt: „Du bist vorhergesehen.“ Nicht als Produkt, sondern als Person. Nicht als Zahl, sondern als Sohn. Und das ist eine Wahrheit, die ich nicht immer greifen kann – aber die mich trägt. Ich glaube, dass meine Berufung nicht in meiner Leistung liegt, sondern in Gottes Blick auf mich. Und das verändert alles. Wenn ich mich von ihm angesehen weiß, dann verändert sich auch mein Blick auf mich selbst.
Zwischen den Zeilen sagt der Text aber auch: Es gibt keine glatte Verherrlichung. Kein Blitzlichtmoment, in dem alles auf einmal perfekt ist. Sondern eine Bewegung. Vom Seufzen zur Hoffnung. Vom Unverständnis zur Gewissheit. Und Gott geht diesen Weg nicht nur mit – er ist schon vorausgegangen. Was der Text definitiv nicht sagt: Dass alles sofort verständlich sein muss. Dass Glaube bedeutet, alles zu wissen oder alles zu fühlen. Paulus nimmt uns diese Illusion. Und das tut gut.
Für mich persönlich ist dieser Text deshalb so entscheidend, weil er mich einlädt, das Seufzen nicht zu verdrängen. Nicht theologisch zu übermalen. Sondern ernst zu nehmen – als Teil des Weges. Er erlaubt mir, ehrlich zu sein. Und doch zu hoffen. Weil Hoffnung nicht bedeutet, keine Zweifel zu haben. Sondern, trotz der Zweifel weiterzugehen. In der Überzeugung: Wenn ich ihn jetzt noch nicht sehe, dann vielleicht, weil ich noch unterwegs bin. Vielleicht, weil seine Gedanken wirklich höher sind – und ich trotzdem darin vorkomme.
Ich merke, dass sich mein Glaube durch diese Auseinandersetzung verändert. Nicht spektakulär, sondern leise. Ich habe weniger Antworten, aber mehr Vertrauen. Weniger Anspruch, alles verstehen zu müssen – aber mehr Mut, trotzdem Ja zu sagen. Nicht zu allem, was passiert – sondern zu dem, der mich ruft. Ich glaube, dass Gott mich sieht. Und ich will lernen, mich selbst durch diesen Blick zu sehen. Nicht als Projekt. Sondern als Geliebter.
Was bleibt, ist ein Weg. Kein Ziel, das ich erreicht habe. Aber ein Ziel, das mich ruft. Und das reicht. Ich bin unterwegs – nicht allein. Und das ist vielleicht schon das größte Geschenk.
Wenn du das mit mir zusammen weiter bedenken willst – dann lies gerne die gesamte Ausarbeitung. Vielleicht findest du dich irgendwo darin wieder.
Der Text:
Zunächst werfen wir einen Blick auf den Text in verschiedenen Bibelübersetzungen. Dadurch gewinnen wir ein tieferes Verständnis und können die unterschiedlichen Nuancen des Textes in den jeweiligen Übersetzungen oder Übertragungen besser erfassen. Dazu vergleichen wir die Elberfelder 2006 (ELB 2006), Schlachter 2000 (SLT), Luther 2017 (LU17), Basis Bibel (BB) und die Hoffnung für alle 2015 (Hfa).
Römer 8,28
ELB 2006: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind.
SLT: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind.
LU17: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind.
BB: Wir wissen aber: Denen, die Gott lieben, dient alles zum Guten. Es sind die Menschen, die er nach seinem Plan berufen hat.
HfA: Das eine aber wissen wir: Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat.
Der Kontext:
In diesem Abschnitt geht es darum, die grundlegenden Fragen – das „Wer“, „Wo“, „Was“, „Wann“ und „Warum“ – zu klären. Das Ziel ist es, ein besseres Bild von der Welt und den Umständen zu zeichnen, in denen dieser Vers verfasst wurde. So bekommen wir ein tieferes Verständnis für die Botschaft, bevor wir uns den Details widmen.
Kurzgesagt… Der Römerbrief wurde in einer Zeit geschrieben, in der das Christentum noch keine Weltreligion war, sondern eine kleine, wachsende Bewegung – verstreut, verfolgt, begeistert. Paulus schreibt an eine Gemeinde, die er noch nie besucht hat, aber auf deren Unterstützung er hofft. Zwischen Ost und West, Vision und Widerstand, steht dieser Brief wie ein Brückenschlag.
Previously on „Römerbrief“… Paulus ist unterwegs – innerlich wie äußerlich. Er hat im Osten gepredigt, Gemeinden gegründet und Konflikte durchlebt. Jetzt steht er an einem Wendepunkt: Sein Blick geht nach Westen – nach Rom, vielleicht weiter bis Spanien. Aber vorher will er nach Jerusalem, um eine Geldsammlung für die dortige Gemeinde zu überbringen. Irgendwo in Griechenland, wahrscheinlich in Korinth, nutzt er die Zwischenzeit, um diesen Brief zu schreiben. Er kennt die Leute in Rom nicht persönlich, aber er weiß: Das, was ihn bewegt, betrifft auch sie. Und bevor er dort auftaucht, will er klarmachen, worum es ihm eigentlich geht.
Der geistige Hintergrund ist alles andere als ruhig. Die Gemeinde in Rom ist bunt gemischt: Judenchristen, Heidenchristen, Altgläubige, Neulinge – und dazwischen jede Menge Fragen. Was gilt noch vom jüdischen Gesetz? Wie funktioniert Gnade? Was ist mit Israel? Und was bedeutet es überhaupt, an Christus zu glauben, mitten in einer Weltmacht, die täglich andere Götter feiert? Paulus schreibt also nicht in ein Vakuum. Er schreibt in einen Spannungsraum aus Identität, Theologie und echter Lebenspraxis. Und er weiß: Missverständnisse sind vorprogrammiert – nicht zuletzt, weil manche sein Evangelium für zu frei, zu gesetzlos, zu gefährlich halten. Deshalb dieser Brief. Kein lockerer Gruß, sondern ein sorgfältig gebautes Fundament. Man spürt: Paulus will nicht nur informieren – er will das Denken der Gemeinde prägen, bevor er selbst vor ihnen steht.
Und dann ist da noch diese unterschwellige Dringlichkeit. Paulus weiß, dass seine Reise nach Jerusalem gefährlich ist. Er bittet später sogar um Gebet, dass er dort heil durchkommt. Vielleicht ahnt er, dass es seine letzte große Missionsreise werden könnte. Und vielleicht ist genau deshalb Römer 8 so etwas wie sein theologisches Herzstück: ein Kapitel voll Trost, Hoffnung, Vergewisserung – inmitten einer Welt, die mehr Fragen als Antworten bereithält.
Alles in allem: Du liest hier einen Brief an Menschen mitten in der Spannung von alter Welt und neuem Glauben, von jüdischer Prägung und heidnischer Umgebung, von Leid und Hoffnung. Und du hörst dabei die Stimme eines Mannes, der weiß, was es heißt, verfolgt zu werden – und trotzdem nicht aufzugeben.
Als Nächstes schauen wir uns an, welche Schlüsselbegriffe in Vers 28 stecken – und warum sie mehr sagen, als man auf den ersten Blick sieht.
Die Schlüsselwörter:
In diesem Abschnitt wollen wir uns genauer mit den Schlüsselwörtern aus dem Text befassen. Diese Worte tragen tiefere Bedeutungen, die oft in der Übersetzung verloren gehen oder nicht auf den ersten Blick ersichtlich sind. Wir werden die wichtigsten Begriffe aus dem ursprünglichen Text herausnehmen und ihre Bedeutung näher betrachten. Dabei schauen wir nicht nur auf die wörtliche Übersetzung, sondern auch darauf, was sie für das Leben und den Glauben bedeuten. Das hilft uns, die Tiefe und Kraft dieses Verses besser zu verstehen und ihn auf eine neue Weise zu erleben.
Römer 8,28 – Ursprünglicher Text (Nestle-Aland 28):
Οἴδαμεν δὲ ὅτι τοῖς ἀγαπῶσι τὸν θεὸν πάντα συνεργεῖ εἰς ἀγαθόν, τοῖς κατὰ πρόθεσιν κλητοῖς οὖσιν.
Übersetzung Römer 8,28 (Elberfelder 2006):
Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind.
Semantisch-pragmatische Kommentierung der Schlüsselwörter
- οἴδαμεν (oidamen) – „wir wissen“: Perfektform von οἶδα, funktional präsentisch. Drückt nicht nur bloßes Wissen aus, sondern ein festes, tief verankertes Erkennen, ein „verinnerlichtes Wissen“, das sich nicht auf äußere Beweise, sondern auf innere Gewissheit gründet. Es ist kein theoretisches Wissen, sondern ein existenzielles „Sich-sicher-Sein“, das hier den Ton vorgibt: Paulus spricht nicht von einer vagen Hoffnung, sondern von einer innerlich durchdrungenen Realität.
- ἀγαπῶσιν (agapōsin) – „die lieben“: Partizip Präsens Aktiv, Dativ Plural – bezieht sich auf eine andauernde, bleibende Haltung. Es geht hier um diejenigen, die Gott fortwährend lieben – nicht punktuell, nicht emotional, sondern als Ausdruck einer auf Gott ausgerichteten Lebenspraxis. Das Verb ἀγαπάω trägt den tiefen Sinn der treuen, selbstlosen Zuwendung. Keine romantische Liebe, sondern eine entschiedene Herzrichtung: Gott als Mittelpunkt.
- πάντα (panta) – „alle Dinge“: Akkusativ Neutrum Plural – umfassend, uneingeschränkt. Es steht betont an erster Stelle im Satz nach dem Relativsatz, was grammatisch unterstreicht: wirklich alles – nicht nur Gutes, nicht nur religiös Aufgeladenes, sondern auch Schmerz, Scheitern, Brüche. Das „Alles“ lässt keine Ausnahmen offen, was semantisch einen gewagten Vertrauensraum eröffnet.
- συνεργεῖ (synergei) – „wirkt mit“ / „arbeitet zusammen“: Präsens Aktiv Indikativ 3. Person Singular – das Subjekt ist implizit Gott. Das Verb stammt von συνεργέω, „zusammenwirken“, „kooperieren“. Es hat kein Subjekt im Griechischen, was Raum für die Auslegung lässt. In jedem Fall ist es eine aktive Dynamik: Gott nimmt die „Dinge“ nicht einfach hin, sondern verwebt sie – oft im Verborgenen – zu einem größeren Ganzen. Semantisch steht hier die Vorstellung eines Zusammenspiels, eines geheimnisvollen Mitwirkens im Fokus – nicht Mechanik, sondern göttliches Handeln im Hintergrundrauschen der Realität.
- εἰς ἀγαθόν (eis agathon) – „zum Guten“: Zielgerichtete Präpositionalphrase. εἰς drückt Bewegung aus – Hinführung auf ein Ziel, in diesem Fall auf „das Gute“. ἀγαθόν ist nicht beliebig „nett“, sondern meint das wirklich Wünschenswerte, das Gott-gemäße. Theologisch mitschwingend: „Gut“ ist nicht immer „angenehm“. Paulus meint kein bequemes Happy-End, sondern Gottes Ziel mit dem Leben des Menschen – und dieses Ziel ist gut, selbst wenn der Weg nicht so aussieht.
- τοῖς κατὰ πρόθεσιν κλητοῖς (tois kata prothesin klētois) – „denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind“: Der zweite Dativsatz beschreibt dieselben wie die Gottesliebenden – aber aus göttlicher Perspektive. πρόθεσις (Vorsatz) ist ein starkes Wort: Es meint nicht einfach Plan, sondern eine vorbereitete, zielgerichtete Absicht – fast liturgisch gedacht (vgl. Brot der Schaustellung im Tempel, gleiche Wortwurzel). κλητοῖς („Berufene“) sind keine Freiwilligen – sie sind Gerufene, Angesprochene, Ausgewählte. Es ist ein passives Partizip: Sie sind nicht die Handelnden, sondern die Empfangenden. Damit wird klar: Diese Berufung ist kein „Jobangebot“, sondern ein Ausdruck göttlicher Initiative.
- οὖσιν (ousin) – „die sind“: Partizip Präsens Aktiv von εἰμί – es macht klar, dass diese Berufenen nicht irgendwann mal berufen wurden, sondern es jetzt sind, im fortwährenden Sein. Identität, nicht Vergangenheit.
Damit ist das semantisch-pragmatische Fundament gelegt. Jetzt können wir im nächsten Schritt theologisch tiefer graben: Was sagt Paulus hier eigentlich über Gottes Handeln – und über unser Vertrauen inmitten einer kaputten Welt?
Ein Kommentar zum Text:
Werfen wir einen Blick in einen Abschnitt, der so klar scheint – und doch mit jedem Vers herausfordernder wird. Römer 8,28–30 ist keine beiläufige Hoffnungsgeste. Es ist einer der dichtesten Texte des Neuen Testaments. Und genau deshalb: Bitte lies ihn langsam. Laut. Mehrmals. Und dann noch einmal.
Wir wissen – sagt Paulus –, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten zusammenwirkt. Klingt das nicht zu schön? Das griechische Wort für „wirken“ hier ist συνεργεῖ (synergei) – das bedeutet „zusammenarbeiten“ oder „zusammenwirken“. Grammatikalisch ist es ein Verb im Aktiv, dritte Person Singular. Der Text lässt offen, ob „alle Dinge“ (πάντα – panta) das Subjekt sind oder ob Gott es ist, der „alle Dinge“ orchestriert. Manche Handschriften – wie Codex Alexandrinus – lesen: „Gott wirkt alle Dinge mit zum Guten“, was Gott selbst eindeutig zum Subjekt macht. Für mich ist es zentral, dass hier keine blinde Kosmosmechanik gemeint ist. Sondern: Ein lebendiger Gott, der auch im Chaos wirksam bleibt – oft jenseits unseres Verstehens.
Aber wem gilt diese Zusage? Paulus sagt: denen, die Gott lieben – den Berufenen gemäß seinem Vorsatz. Das Wort für „Vorsatz“ hier ist πρόθεσις (prothesis) – und das meint im griechischen Kontext einen bewusst gefassten Plan. Es ist derselbe Begriff, den Paulus in Epheser 1,11 verwendet, wo er von Gottes Ratschluss spricht, „alles nach dem Rat seines Willens“ zu wirken. Das ist kein blinder Plan, sondern eine Liebesabsicht Gottes. Nicht mechanisch, sondern beziehungshaft.
Dann folgen die berühmten fünf Verben: vorhererkannt – vorherbestimmt – berufen – gerecht gemacht – verherrlicht. Eine sogenannte „Heilskette“ (ordo salutis), die in Vers 30 ihren Höhepunkt findet. Doch Vorsicht. Diese Kette wirkt stabil, fast lückenlos – aber sie ist theologisch kein Fließband. Besonders das erste Verb verdient Aufmerksamkeit: „vorhererkennen“ – griechisch: προέγνω (proegnō). Es bedeutet nicht bloß „wissen im Voraus“, sondern verweist in der Bibel oft auf eine tiefe, persönliche Zuwendung. So auch in Amos 3,2: „Euch allein habe ich erkannt (ידעתי – yada’ti) unter allen Völkern“ – gemeint ist: geliebt, erwählt, nicht bloß beobachtet.
Frank Thielman betont, dass diese „Erkenntnis“ auf Gottes Liebesbeziehung verweist, nicht auf bloße Voraussicht. „Gott sieht nicht nur vorher, er bindet sich vorher.“ (Thielman, Romans). Für Thielman ist das kein metaphysischer Determinismus, sondern ein Ausdruck göttlicher Initiative, die zur Beziehung ruft. Und genau das ist für meine adventistische Sicht entscheidend: Erwählung ist kein Schicksal, sondern ein Ruf in die Nachfolge – mit echter Verantwortung.
Was bedeutet dann „vorherbestimmen“ – προώρισεν (proōrisen)? Douglas Moo warnt davor, diesen Begriff als Zwang zu deuten. Vielmehr bedeute er, „eine Richtung zu setzen“ – wie ein Ziel, das Gott denen vorgibt, die er liebt (Moo, The Epistle to the Romans). Dieses Ziel ist: „dem Bild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden“. Das griechische Wort ist σύμμορφοι (symmorphoi) – von morphē, „Gestalt“ oder „Form“. Es geht also nicht um äußerliche Kopie, sondern um innere Übereinstimmung. Für Moo ist das ein Prozess, kein Zustand. Und er verweist auf Philipper 3,21, wo Christus unseren Leib „umgestalten wird“ zur Gleichgestalt mit seinem Leib.
Heinrich Schlier ergänzt dazu, dass die Verherrlichung bereits jetzt im Leben des Gläubigen beginnt – durch den Heiligen Geist, der uns „innerlich auf die kommende Herrlichkeit ausrichtet“ (Schlier, Römerbrief). Doch diese Gleichgestaltung ist für ihn kein moralisches Projekt, sondern Frucht einer existenziellen Zugehörigkeit zu Christus. Ich frage mich da: Ist das heute in unseren Gemeinden noch spürbar – dass es nicht um Leistung, sondern um Angleichung im Blickkontakt mit Christus geht?
Barth sieht in dieser Gleichgestaltung ein eschatologisches Ziel – also eine auf die Zukunft gerichtete Hoffnung –, aber nicht ohne schon jetzt wirksame Wirklichkeit. Er schreibt: „Gott handelt mit dem Menschen, indem er ihn zu dem bestimmt, was er noch nicht ist – aber in Christus schon sein darf.“ (Barth, KD IV/1). Das ist stark, weil es Hoffnung gibt – aber es bleibt in der Spannung: Wie viel ist jetzt schon sichtbar? Wie viel bleibt verborgen?
Adolf Schlatter legt hier besonderen Wert auf die Aoristform der Verben – auch bei „verherrlicht“ (ἐδόξασεν – edoxasen). Für ihn ist das kein Hinweis auf eine vergangene Realität, sondern Ausdruck der Festigkeit der göttlichen Zusage. „Was Gott verheißen hat, ist im Himmel schon Realität.“ (Schlatter, Römerbrief). Für ihn ist die Verherrlichung Ausdruck göttlicher Perspektive: Gott sieht das Ende von Anfang an. Das mag trösten – aber: Was bedeutet es, wenn ich heute noch alles andere als „verherrlicht“ aussehe?
Scott Hahn bringt eine andere Note ein. Für ihn ist diese Berufung eingebettet in eine familiäre Beziehung: „Gott ruft nicht in ein System, sondern in ein Zuhause.“ (Hahn, Romans). Das Bild ist stark, aber theologisch komplex – denn Hahn versteht diesen Ruf letztlich sakramental: Die Taufe als Eintritt in die Erwählung. Als Adventist würde ich hier widersprechen. Für mich ist die Erwählung nicht automatisch mit einem Ritus verbunden, sondern mit einer persönlichen Antwort auf Gottes Ruf – aus Gnade, aber nicht ohne Entscheidung.
Eckhard Schnabel betont, dass diese „Kette“ nicht als Garantielinie zu lesen ist – sondern als Beschreibung derjenigen, die im Glauben durchhalten. Er bringt Römer 11,22 ins Spiel: „Bleibe in seiner Güte – sonst wirst auch du abgehauen werden.“ (Schnabel, Paulus und die Logik des Evangeliums). Für ihn ist Römer 8,30 kein Heilsautomatismus, sondern eine Einladung zur Treue. Und das ist genau meine theologische Spannung: Gott schenkt alles – aber wir sind gerufen, im Glauben zu bleiben (vgl. Offenbarung 14,12).
Karl Barth wiederum lenkt den Fokus auf die Subjektivität Gottes: Gott handelt – der Mensch empfängt. „Der Mensch ist Gegenstand, nicht Subjekt der Erwählung.“ (Barth, KD II/2). Das klingt befreiend – aber lässt es Raum für echte Entscheidung? Ich bleibe da innerlich unruhig. Denn für mich ist Glaube mehr als Hinnahme – er ist Antwort. Beziehung. Auch Ringen.
Frank Thielman bringt hier eine hilfreiche Balance: Er betont, dass Berufung und Rechtfertigung bei Paulus nie unabhängig vom Glauben geschehen. Römer 5,1: „Da wir nun gerechtfertigt worden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott.“ Das ist für ihn der Schlüssel: Die göttliche Initiative ruft – aber der Mensch antwortet im Glauben.
Was bleibt am Ende? Keine lückenlose Systematik. Sondern ein ehrliches Staunen. Dass Gott alles wirken kann – sogar das Schwere. Dass er uns kennt – bevor wir ihn suchen. Dass er ruft, rechtfertigt, verherrlicht – und doch nicht entmündigt. Dass diese Verse mehr Zusage als Analyse sind.
Und doch bleibt eine Frage offen – vielleicht die wichtigste: Wenn Gott alles wirkt – wo bleibe ich? Nicht als Zweifel, sondern als Staunen.
Zentrale Punkte der Ausarbeitung
- Gott wirkt – aber nicht mechanisch.
- Die Verben in dieser Perikope klingen wie eine fertige Kette: vorhererkannt – vorherbestimmt – berufen – gerecht gemacht – verherrlicht. Aber Paulus schreibt keine Theologie des Schicksals, sondern eine Einladung zum Vertrauen. Der griechische Text und die Kontexte machen deutlich: Gott ist aktiv – aber nicht automatisch. Es geht nicht um ein himmlisches Fließband, sondern um eine beziehungsbezogene Zusage.
- Gerade das Wort „vorhererkennen“ – proegnō – bedeutet nicht „wissen im Voraus“, sondern „lieben im Voraus“. Das verändert alles: Erwählung ist kein Kalkül, sondern Hingabe.
- Die Berufung ist echt – aber sie ruft zur Antwort.
- Wer berufen ist (ekalesen), ist nicht zwangsläufig schon „drin“. Paulus lässt offen, ob jeder Berufene auch durchhält. Es ist eine Einladung zur Treue, keine automatische Heilszusage.
- Als Adventist verstehe ich diese Berufung immer im Spannungsfeld von Gnade und Gehorsam. Die Schrift ruft uns auf, in der Güte Gottes zu bleiben (Römer 11,22). Das ist kein Widerspruch – sondern Teil echter Nachfolge.
- Verherrlichung ist Ziel – aber auch Prozess.
- Das letzte Verb „verherrlicht“ (edoxasen) steht grammatikalisch in der Vergangenheitsform. Doch es beschreibt etwas, das aus unserer Sicht noch aussteht.
- Für Schlatter ist das die Perspektive Gottes: „Was Gott beschlossen hat, ist in seiner Wirklichkeit schon vollendet.“ Das klingt stark – aber auch herausfordernd. Für mich bedeutet das: Gott sieht mein Leben aus einer Ewigkeitsperspektive, auch wenn ich selbst manchmal im Nebel stehe.
- Gleichgestaltung mit Christus ist kein Idealbild – sondern Identitätsverwandlung.
- Das Ziel von Gottes Ruf ist, dass wir „dem Bild seines Sohnes gleichgestaltet“ werden – symmorphoi. Das meint nicht: wir müssen Jesus „nachmachen“. Sondern: Gott prägt unser Inneres neu, damit wir ihm wirklich ähnlich werden.
- Für mich als Adventist heißt das: Es geht nicht um moralische Selbstoptimierung, sondern um echte Charakterreifung durch die Gegenwart des Heiligen Geistes (vgl. Galater 5,22–23).
- Theologische Sicherheit braucht geistliche Ehrlichkeit.
- Die große Gefahr in der Auslegung dieser Verse ist, sie zu „glatt“ zu lesen – als sei alles geklärt, alles vorherbestimmt. Doch die Bibel lässt Raum für Spannung, Ringen, Antwort. Genau diesen Raum nimmt der Kommentar ernst.
- Barth, Moo, Schlier und Thielman kommen hier in einen echten Dialog – nicht um ein harmonisches Bild zu malen, sondern um die Tiefe und Widersprüchlichkeit göttlicher Erwählung auszuloten.
Warum ist das wichtig für mich?
- Weil ich oft zwischen Vertrauen und Unsicherheit schwanke.
- Dieser Text gibt mir keine einfache Antwort, aber eine klare Einladung: Gott kennt mich, bevor ich ihn kenne. Und er hört nicht auf, mich zu rufen – auch wenn ich schwach bin.
- Weil ich wissen will, ob mein Glaube trägt.
- Römer 8,28–30 stellt nicht mich ins Zentrum, sondern Gott. Aber es macht mich nicht überflüssig – es macht mich verantwortlich. Das ist befreiend. Und zugleich ernst.
- Weil ich als Adventist glauben will, dass Gnade nicht gegen Gehorsam steht.
- Die Perikope hilft mir, beides zu verbinden: Die Tiefe der göttlichen Initiative – und den Ruf zur Treue, zur Verwandlung, zur Hoffnung auf Jesu Wiederkunft.
Der Mehrwert dieser Erkenntnis
- Ich darf glauben, dass Gottes Plan nicht über meinen Kopf hinweg läuft – sondern mich meint.
- Ich kann mitten in meinem fragmentierten Leben wissen: Es ist noch nicht vollendet – aber es ist nicht bedeutungslos.
- Ich lerne, Gott nicht aus einer theologischen Theorie heraus zu begegnen – sondern aus dem Vertrauen, dass er handelt. Heute. In mir.
Kurz gesagt: Wieder einmal… wenn Gott ruft, dann nicht in ein System, sondern in eine Beziehung – und wer sich rufen lässt, tritt in eine Geschichte ein, die größer ist als seine Fragen, aber nicht kleiner als sein Glaube.